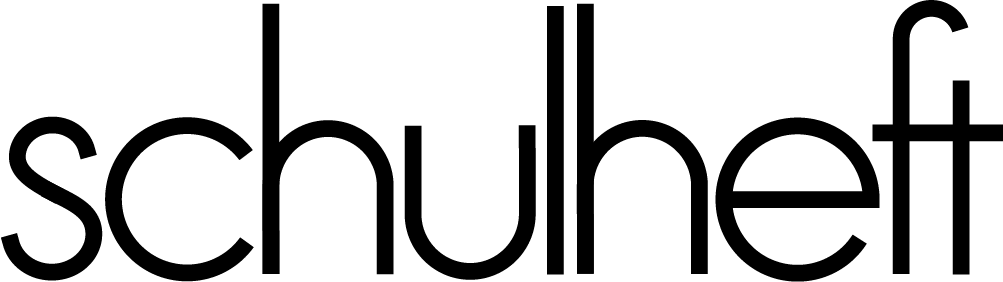Pädagogisierung
Michael Sertl Thomas Höhne Ingolf Erler ErichRibolits Karlheinz Geißler Frank Michael Orthey Elke Gruber Erich Ribolits Franz Schandl Im Frühjahr dieses Jahres konnte man in der Zeitung lesen, dass einige Wiener Schulen das Problem des anwachsenden Schulstresses bei Schüler/innen und Lehrer/innen in einer - wie es hieß - alternativen Form zu lösen versuchen: Quasi als Erste Hilfe werden Shaolin Mönche im Auftrag der Wiener Privatuniversität für Traditionelle Chinesische Medizin 500 Lehrer/innen Grundübungen der meditativen Atem- und Bewegungstechnik Qi Gong beibringen. In einem zweiten Schritt sollen dann 200 Lehrer/ innen in mehreren Wochenendseminaren eine fundierte Ausbildung in Qi Gong erhalten, sodass sie später selbst stress- und spannungslösende Techniken an Schüler/innen weitergeben können. Die Bedingungen des schulischen Arbeitens sind offenbar bereits derart von Hektik und Druck gekennzeichnet, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Allerdings wird der himmelschreiende Umstand, dass in jener Einrichtung, deren Name sich bekanntlich von »schole«, dem Wort für Muße ableitet, Stress schon zu einem Alltagsphänomen geworden ist, nicht zum Anlass genommen, um den Ursachen dieser Entwicklung nachzugehen und ihre Veränderung anzustreben. Ändern sollen sich die Stressopfer, sie - die Lehrer/innen und Schüler/innen - sollen lernen, mit Stress besser zurechtzukommen; die Entspannungstechniken sollen sie in die Lage versetzen, sich an die Stressbedingungen anzupassen und diese besser ertragen zu können. Hier findet eine eindeutige Täter-Opfer-Umkehrung statt, ein gesellschaftliches Problem wird zu einem individuellen umgedeutet. In der Folge heißt das selbstverständlich auch: Wer das - übrigens von einer parteinahen Gesellschaft für Bildungspolitik initiierte - tolle Hilfsangebot nicht annimmt oder die asiatischen Entspannungstechniken vielleicht nicht genug intensiv übt, ist selber schuld! Mehr lässt sich denn nun wirklich nicht tun, als sogar uraltes chinesisches Wissen und original Shaolin Mönche dafür aufzubieten, um den Betroffenen ein Mittel in die Hand zu geben, sich mit den Umständen besser arrangieren zu können - dass eine Gesellschaft für Bildungspolitik politische Strategien zur Lösung des Problems angehen könnte, ist ja nun wirklich nicht zu erwarten. Die geschilderte Situation ist ein beliebig herausgegriffener Aspekt einer Entwicklung, die in diesem Heft unter dem Titel "Pädagogisierung" behandelt wird. In vielfältiger Form lässt sich derzeit konstatieren, dass zur Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemen, die sich nicht mehr leugnen lassen, zunehmend nicht politische, rechtliche oder ökonomische, sondern pädagogische Strategien favorisiert werden. Zum Teil ist dies tagtäglich darin beobachtbar, dass jedes Mal, nachdem ein Misstand - egal ob es sich dabei um den um sich greifenden Rechtsradikalismus, die Ausbreitung von Aids oder Probleme bei der Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen handelt - in das gesellschaftliche Bewusstsein rückt, sofort nach entsprechenden schulischen Gegenaktivitäten gerufen wird. Tatsächlich stellt das an die Stelle Treten von pädagogischen Maßnahmen dort, wo eigentlich politisches Handeln angebracht wäre, ein viel umfassenderes Phänomen dar. In diesem Sinn wird im ersten Teil des vorliegenden Heftes versucht, sehr systematisch zu hinterfragen, was unter Pädagogisierung verstanden wird und welche gesellschaftliche Logik der unter diesem Titel firmierenden Entwicklung zugrunde liegt. Im zweiten Teil geht es dann um verschiedene konkrete Erscheinungsformen des Pädagogisierungsphänomens. Der Einstieg in die Thematik erfolgt anhand eines Artikels von Erich Ribolits, in dem dieser nachweist, dass Pädagogisierung gewissermaßen eine auf die gesamte Lebensspanne der Individuen ausgedehnte Erziehung bedeutet. Dies zeigt sich auch in Basil Bernsteins Arbeit "A Totally Pedagogised Society", die Michael Sertl in seinem Artikel analysiert und dabei einerseits den Verlust der bürgerlichen Idee der Bildung beklagt und andererseits die "Unwilligkeit" (?) der Linken konstatiert, das Konzept der Wissens- Gesellschaft einer genaueren Analyse zu unterziehen und darin nicht nur einen "Schmäh" des globalisierten Kapitalismus zu sehen. Thomas Höhne stellt in seinem Artikel die Frage, ob die gegenwärtige Dominanz pädagogischer Topoi und Diskurse ein Indiz für eine "Pädagogisierung" anderer Bereiche (als die der Schule) ist, der Ökonomie etwa, und ob damit ein neues hegemoniales Wissen und eine neue Form des "Regierens" (Foucault) verbunden ist. Die Funktion der Pädagogisierung als eine Art "Selbstkontrollapparatur" (Elias), also die Veränderung der Psychostrukturen der Menschen und die Etablierung einer "Disziplinargesellschaft" (Foucault) und die Folgen für das je eigene "subversive" Handeln zeigt Ingolf Erler. André Gorz’ Buch "Wissen, Wert und Kapital, Zur Kritik der Wissensökonomie", in dem Gorz die These aufstellt, dass der gegenwärtig stattfindende Bedeutungsgewinn von Wissen zur wichtigsten Produktivkraft die Grundprämissen des Kapitalismus nachhaltig untergräbt, diese Entwicklung somit letztendlich sein Ende ankündigt, bespricht Erich Ribolits. An die Frage "Warum wird heute soviel gelernt" knüpft Karlheinz Geißler die subversive Hoffnung, dass die Menschen mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, als der Staat und die Wirtschaft brauchen können. Frank Michael Ortheys Beitrag richtet sich gegen die "Logik der Verwertung und Verzweckung" und fordert überlebenswichtige Widerstände von der Sorte "Wider-mehr-Bildung". Als Resümee aus der neoliberalen Transformation der Gesellschaft kommt Elke Gruber zum Schluss, dass Lernen zum universellen Veränderungsmodell in modernen Gesellschaften hochstilisiert wird. Im Artikel "Vom Lehrer zum Lerncoach" räumt Erich Ribolits mit der Illusion vieler LehrerInnen auf, sie könnten ihre SchülerInnen über den Weg besonders avancierter Unterrichtsmethoden zu kritischen und selbstbewussten Menschen heranbilden. Franz Schandl schließlich kommt zum Ergebnis, dass nur die Abschaffung der Arbeit zur individuellen Verwirklichung führt. Die angeführten Bücher unserer Autoren empfehlen wir unseren LeserInnen. Erich Ribolits, Johannes Zuber Erich Ribolits Erler Ingolf, Studium der Soziologie, Mitarbeit in der ÖH an der Universität Wien Geißler Karlheinz A., Univ.Prof. Dr. rer. pol., Erziehungswissenschafter, Universitätsprofessor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr München; Gastprofessuren im In- und Ausland; Vorstand er Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik Gruber Elke, Univ.Prof. Mag. Dr., Erziehungswissenschafterin, Leiterin der Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung am Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Universität Klagenfurt Orthey Frank Michael, Dr., langjähriger Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr in München, Berater und Trainer für Profit- und Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien Höhne Thomas, Dr., Erziehungswissenschafter, langjährige Tätigkeit in der Erwachsenenbildung (Deutsch als Fremdsprache), wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung für Erwachsenen-/ Altenbildung der Universität Gießen Ribolits Erich, Univ.Prof. Dr., Erziehungswissenschafter, Mitarbeiter an der Agrarpädagogischen Akademie Wien sowie an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien, Lehraufträge und Gastprofessuren Schandl Franz, Dr., Historiker, Mitherausgeber der Wiener Streifzüge, Autor und freier Journalist Wien Sertl Michael, Dr., Soziologe, Prof. an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Wien Studienverlag: Schulheft 116Klappentext

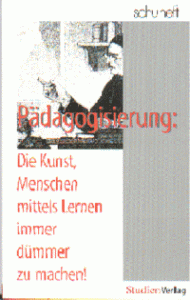 Die Bedingungen des schulischen Arbeitens sind offenbar bereits derart von Hektik und Druck gekennzeichnet, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Die Bedingungen des schulischen Arbeitens sind offenbar bereits derart von Hektik und Druck gekennzeichnet, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Hier wird vor allem der Begriff "Pädagogisierung" und seine gesellschaftliche Entwicklung analysiert und hinterfragt. Pädagogisierung meint heute nicht mehr nur Expansion eines gesellschaftlichen Teilsystems oder die Durchdringung der Gesellschaft mit pädagogischen Konzepten und Semantiken - Pädagogisierung geht tiefer, sie hat das Subjekt erreicht!Inhalt
A Totally Pedagogised Society
Basil Bernstein zum Thema
Pädagogisierung sozialer Machtverhältnisse
Selbstdisziplinierung des flexiblen Menschen
"Schmiermittel . . . eines zukünftigen Akkumulationszyklus"
Exkurs: Gorz, André: Wissen, Wert und Kapital
Zur Kritik der Wissensökonomie. Eine Buchrezension
Bildung und Einbildung
zwielichtiges lernen
Über Grenzen, Zumutungen und andere Seiten des Lernens
Pädagogisierung der Gesellschaft und des Ich durch lebenslanges Lernen
Vom Lehrer zum Lerncoach?
Eine irre Ideologie
Aktuelle Notizen zum ArbeitswahnVorwort
AutorInnen
Redaktion
Johannes ZuberAutorInnen
Bestellen