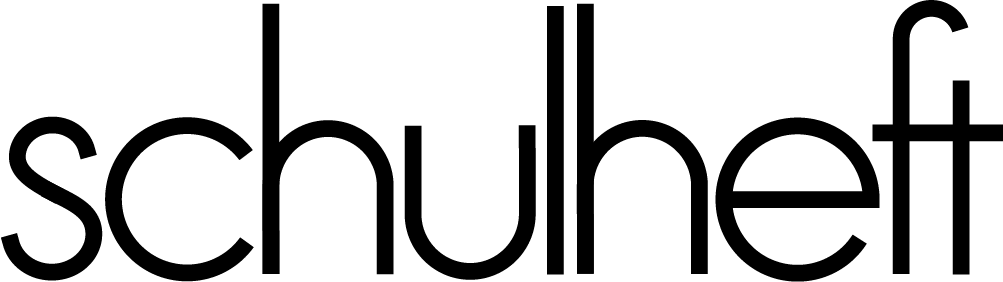Emanzipatorische (Volks)Bildungskonzepte
Mit Beiträgen von Maria Denkmayr, Birgit Fritz, Michaela Hauer, Frigga Haug, Ulrich Klemm, Pia Lichtblau, Margarete Meixner, Teresa Nadeje, John Nyambe, Franz Ofner, Alexander Ragossnig und Carlos Roberto Winckler. Franz Ofner Carlos Roberto Winckler Frigga Haug Ulrich Klemm John Nyambe Maria Denkmayr, Teresa Nadeje Alexander Ragossnig Birgit Fritz Michaela Hauer, Pia Lichtblau Margarete Meixner Michaela Hauer, Pia Lichtblau Die vorliegende Ausgabe des schulhefts hat im Wesentlichen zwei Ausgangspunkte. Der erste Ausgangspunkt ist ein Forschungsprojekt von Pia Lichtblau und Michaela Hauer zu den Incubadoras Universitarias in Brasilien (siehe Artikel in dieser Nummer). Diese universitären Gründungszentren bilden Schnittstellen zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen und wenden sich ganz bewusst an „unterdrückte“ Menschen, um gemeinsam mit ihnen in dialogisch organisierten Bildungsprozessen Realitäten zu hinterfragen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Diese Prozesse gehen über eine reine Wissensvermittlung weit hinaus und orientieren sich an der Pädagogik und Philosophie Paulo Freires. Dieser Name steht für eine politische Bildungsarbeit, die Alphabetisierung und Befreiung zusammendenkt. Seine Ideen stecken in vielen Volksbildungsprojekten, die – beginnend in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts – sich als Beitrag zur Befreiung der unterdrückten Klassen verstehen. In unseren Breitengraden steht der Name stellvertretend für eine Tradition emanzipatorischer Erwachsenenbildung, bei der nicht mehr so sehr Freires Methode der Alphabetisierung im Vordergrund steht, sondern vielmehr seine Haltung gegenüber den Unterdrückten, die auf Respekt und einem Dialog auf gleicher Ebene basiert. Ein Ziel unserer Redaktionsarbeit war es nachzufragen, wie es eigentlich um emanzipatorische Projekte in diesem Bereich heute steht. Der zweite Strang, der schließlich zur endgültigen Form dieses schulhefts geführt hat, waren Erfahrungen mit und Kontakte zu Bildungsprojekten „im Süden“. Hier berichten LehrerInnen und BetreiberInnen aus dem Norden und ein Schulentwickler aus dem Süden über die Probleme des Bildungswesens in den Staaten des Südens. In diesen Berichten verlassen wir den eigentlichen Fokus dieses schulhefts, nämlich die Erwachsenenbildung, und werfen einen Blick auf die Grundschulbildung dieser Länder. Damit ist die Struktur dieser Nummer gegeben: Im ersten Teil werden einige grundsätzliche Positionen zu den „Emanzipatorischen Bildungskonzepten“ dargestellt; im zweiten Teil werden Projekte aus Ländern des Südens vorgestellt; der dritte Teil widmet sich Projekten aus Österreich. Dem Artikel von Franz Ofner haben wir auch den Titel der ganzen Nummer entnommen: Selbstbefreiung oder Inklusion. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Hier ist nicht die in der Sonderpädagogik diskutierte inklusive Pädagogik gemeint, sondern das vermutlich diesem Inklusionsverständnis zugrunde liegende sozialpolitische Konzept einer Inklusion, die im Vergleich zu Armut und ähnlichen Konzepten den Fokus mehr auf die Prozesse der Exklusion und deren Verhinderung legt. Ofner stellt die systemtheoretischen Wurzeln dieser neuen Sichtweise dar und weist auf einige Probleme hin, die sich gerade im Zusammenhang mit Bildung daraus ergeben. Inklusion mag zwar neue Sichtweisen eröffnen. Die Verbindung mit Befreiung, für die Paulo Freire steht, gelingt aber nicht. Einen Überblick über das Werk und die Spuren Paulo Freires in der brasilianischen Gesellschaft liefert der brasilianische Soziologe Carlos Alberto Winckler. Er demonstriert, wie schwierig der politische Kampf in der jüngeren brasilianischen Geschichte zwischen Widerstand, Exil und Vereinnahmung zu führen ist. Daneben zeichnet der Artikel u.a. auch die Verbindungen von Freires Denken zu marxistischen Klassikern wie Gramsci und Makarenko nach. Um zwei dieser marxistischen Klassiker der Volksbildung, Rosa Luxemburg und Antonio Gramsci, und deren Sicht einer befreienden Pädagogik geht es auch in der Analyse von Frigga Haug. Schließlich beendet Ulrich Klemm diesen theoretischen Block mit einer Darstellung historischer und aktueller Konzepte der anarchistischen Schulkritik und libertären Pädagogik. Am Beginn des zweiten Kapitels stehen drei Berichte, die sich grundlegend unterscheiden. Während der erste, ein Bericht aus Namibia, aus der Sicht der Betroffenen oder zumindest von einem Vertreter dieser vom Kolonialismus geprägten Länder und Bildungssysteme geschrieben ist, sind die andern beiden Berichte über Indien und Uganda von ÖsterreicherInnen geschrieben, die ihre Erfahrungen mit alternativen Bildungsprojekten in diesen Ländern schildern. Wir haben uns erlaubt, diese grundlegende Differenz auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass wir den ersten Artikel im englischen Original belassen haben. John Nyambe zeigt, dass die überzeugende Formel von einem Wandel der teacher centred pedagogy des kolonialen Systems zur learner centred pedagogy des postkolonialen Systems so einfach nicht zu verwirklichen ist. Er verweist darauf, dass solche Vermengungen von politischer Rhetorik und pädagogischen Konzepten eher problematisch sind. Maria Denkmayr und Teresa Nadeje unterziehen ihre eigene Mitarbeit an einem an Montessori orientierten alternativen Bildungsprojekt in Uganda einer kritischen Reflexion. Ihr Resümee: Solche punktuellen Initiativen stehen in einem problematischen Kontrast zur grundsätzlichen Bildungsmisere in diesen Ländern. Ein etwas optimistischeres Bild zeichnet Alexander Ragossnig von einem Projekt in Indien. Er sieht sehr wohl Nutzen und Chancen für jene, die das öffentliche Bildungswesen links liegen lässt. Ebenfalls aus Indien stammt die Bewegung Jana Sanskriti, eine vom kürzlich verstorbenen Theaterpädagogen Augusto Boal und Paulo Freire inspirierte Form des „Theaters der Unterdrückten“, über das Birgit Fritz berichtet. Damit sind wir wieder bei der Erwachsenenbildung. Am Schluss dieses Blocks berichten Michaela Hauer und Pia Lichtblau, wie schon angedeutet, über die Incubadoras an brasilianischen Universitäten. Die letzten beiden Artikel berichten über Initiativen in Österreich, die Parallelen vorweisen und/oder in denen emanzipatorische Bildungsansätze in der Praxis gelebt werden. Auch in Österreich gibt es die politische Theaterbewegung und Margarete Meixner, eine der BegründerInnen, berichtet anschaulich über das Forumtheater und seine Anwendung. Schlussendlich begeben sich Michaela Hauer und Pia Lichtblau auf die Suche nach emanzipatorischen Bildungskonzepten in österreichischen Organisationen und finden Reste einer Tradition, die im weiteren Sinne mit dem Namen Paulo Freire verbunden werden kann. Michael Sertl, Michael Hauer, Pia Lichtblau Maria Denkmayr, Studierende an der PH Wien (Sonderpädagogik) Birgit Fritz, Theaterpädagogin, Mitgründerin des Theaters der Unterdrückten, Lektorin für transkulturelle Theaterarbeit an der Universität Wien Michaela Hauer, Forschungsprojekt „Educação popular hoje“ des Paulo Freire Zentrums Wien/Brasilien in Brasilien Frigga Haug, Soziologin und Sozialpsychologin, Mitherausgeberin der Zeitschrift „Das Argument“ und des historisch kritischen Wörterbuchs des Marxismus Margret Jäger, Anthropologin, Associated Professor Bundesuniversität Pará/Brasilien Ulrich Klemm, Diplom-Pädagoge, derzeit als Honorarprofessor für Erwachsenenbildung an der Universität Augsburg und Lehrauftrag an der Pädagogishen Hochschule Weingarten Susanne Köck-Kossarz, AHS-Lehrerin Pia Lichtblau, Forschungsprojekt "Educação popular hoje" des Paulo Freire Zentrums Wien/Brasilien in Brasilien Margarete Meixner, Theaterpädagogin, Leiterin des SOG. THEATERS Wiener Neustadt Teresa Nadeje, Studierende an der PH Wien (Sonderpädagogik) John Nyambe, National Institute for Educational Development, Namibia Franz Ofner, Soziologe, Universität Klagenfurt Alexander Ragossnig, Soziologe Michael Sertl, ehemaliger Hauptschullehrer, Soziologe an der Pädagogischen Hochschule Wien Carlos Roberto Winckler, Soziologe der Stiftung für Wirtschaft und Statistik/Porto Alegre und Dozent der Stiftung Universität von Caxias do Sul /Rio Grande do Sul/Brasilien Studienverlag: Schulheft 134Klappentext

 Dieses schulheft untersucht, wie es heute um emanzipatorische Volksbildungsprojekte beschaffen ist. Den Beginn solcher Projekte markiert ein Name, der für "Befreiungspädagogik" schlechthin steht: Paulo Freire.
Dieses schulheft untersucht, wie es heute um emanzipatorische Volksbildungsprojekte beschaffen ist. Den Beginn solcher Projekte markiert ein Name, der für "Befreiungspädagogik" schlechthin steht: Paulo Freire.
Die AutorInnen fragen nach gut 30 Jahren nach der Rezeption Freires und was "Bildung" für Unterdrückte heißen kann: in Brasilien, in Indien, in Uganda, in Namibia, in Österreich. In Zeiten der neoliberalen Neuformierung gesellschaftlicher Verhältnisse gerät der Begriff der "Befreiung" schnell in den Sog einer das System stützenden "Inklusion".
Das schulheft verweist auf diese Gefahr und wirft seinen Blick auch auf andere "Befreiungspädagogiken": auf Gramsci, Rosa Luxemburg und auf die libertäre Pädagogik.Inhalt
Selbstbefreiung oder Inklusion
Freires Wege
Emanzipatorische Volksbildung bei Luxemburg und Gramsci
„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“
Über den Zusammenhang von Freiheit, Anarchismus und Pädagogik
Learner-Centred Pedagogy: Pedagogic Emancipation and Democratisation in Post-Apartheid Namibia
„For us, we are here in Africa...“
Ein Schulprojekt in Uganda und seine Schwierigkeiten
Das „Learn for Life-Projekt“ – Bildung ohne Grenzen
Jana Sanskriti – The People’s Culture
Das indische „Theater der Unterdrückten“-Netzwerk geht mutig, lustvoll und beharrlich seinen Weg
Incubadoras in Brasilien – Brutkästen emanzipatorischer Bildung
„Unterdrückung herrscht dort, wo der Monolog den Dialog ersetzt“
Forumtheater nach Augusto Boal
Freires Spuren in ÖsterreichVorwort
AutorInnen
Bestellen