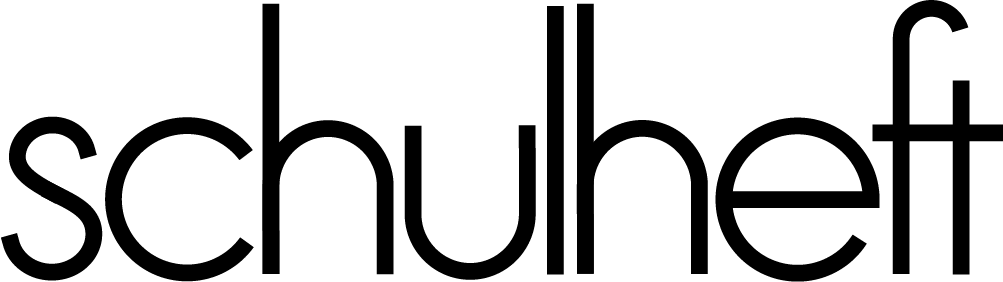Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?
Die Beiträge analysieren, wie Weiterbildung zu einer (unpassenden) Antwort auf gesellschaftliche Fragen gemacht wird. Neoliberale Wurzeln aktueller Weiterbildungsforderungen werden dabei ebenso thematisiert wie aktuelle Entwicklungen in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Editorial Peter McLaren Wilhelm Filla Daniela Holzer Ingolf Erler Astrid Messerschmidt Daniela Rothe Ulla Klingovsky/Susanne Pawlewicz maiz*Frauen Erich Ribolits Rezension: Einendes und Trennendes AutorInnenverzeichnis Auf gesellschaftliche, ökonomische, soziale und individuelle Problemstellungen wird derzeit gebetsmühlenhaft als Antwort mit Aufträgen an Erwachsenenbildung und Weiterbildung reagiert. Von Arbeitslosigkeit, unternehmerischem Wettbewerb, subjektivem Leiden an gesellschaftlichen Verhältnissen bis hin zu gesundheitlichen oder ökologischen Fragen wird als ein zentrales und von den Individuen selbst zu verantwortendes Szenario der Problembeseitigung Erwachsenen- und Weiterbildung entworfen. Diese Antwort„automatik“ gilt es kritisch in den Blick zu nehmen. Die leitende Frage dazu gibt dieser Ausgabe des schulheftes den Titel: „Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?“ In dieser Ausgabe des schulheftes wird in den Beiträgen kritisch analysiert und reflektiert, inwiefern Erwachsenen- und Weiterbildung zu einer (unpassenden) Antwort auf gesellschaftliche Fragen gemacht werden. In vielfältigen Facetten wird danach gefragt, mit welchen Begründungen Erwachsenen- und Weiterbildung in der derzeitigen vorrangig systemstabilisierenden und nutzenorientierten Form vorangetrieben wird. Neoliberale Wurzeln aktueller Weiterbildungsforderungen werden dabei ebenso thematisiert wie aktuelle Entwicklungen in der Erwachsenen- und Weiterbildung, schließlich wird auch nach kritischen Alternativen Ausschau gehalten. Diese Ausgabe des schulheftes wird von einem Beitrag von Peter McLaren eröffnet. Peter McLaren, einer der wichtigsten Vertreter_innen kritischer Pädagogik in den USA, umreißt in seinem Beitrag eine radikal kritische Analyse kapitalistischer Gesellschaften, und er formuliert mit seiner revolutionären kritischen Pädagogik einen Weg, diese Verhältnisse zu überwinden. Dieser Beitrag macht nun einige Ansätze der Arbeiten von Peter McLaren auch in deutscher Übersetzung zugänglich.1 Wilhelm Filla führt in seinem Beitrag aus, dass kritische Erwachsenenbildung als Bildungstätigkeit und ihre Wissenschaft, die sich zu den gesellschaftlichen Verhältnissen kritisch verhält und diese in ihrem Werden und in den Veränderungs- und Aufhebungsmöglichkeiten thematisiert, nicht auf „politische Bildung“ begrenzt bleibt. Kritische Erwachsenenbildung thematisiert überdies gesellschaftliche Kräfte, die in der Lage sind, Alternativen zu formulieren und Kritik in gesellschaftliche Praxis umzusetzen. Die Streitschrift von Daniela Holzer nähert sich einer grundlegenden Diskussion von Fragen und Antworten im Kontext von Erwachsenenbildung. Wenn von einer kritischen Haltung ausgegangen wird, so sind gestellte, nicht gestellte und vergessene Fragen und Antworten daraufhin zu befragen, inwiefern sie an kritischen Kriterien gemessen als richtig oder falsch beurteilt werden können. Im Beitrag wird nachgespürt, welche falschen Fragen und Antworten rund um die Weiterbildung hervorgebracht werden. Ingolf Erler widmet sich in seinem Beitrag der Betrachtung gesellschaftlicher Umbrüche, die nicht nur zu neuen Lebensverläufen führen, sondern insbesondere neue Unsicherheiten hervorbringen. Unter veränderten Produktions- und Arbeitsbedingungen werden in neuer Form Anforderungen an die Menschen herangetragen, und als scheinbare Lösungen werden unter anderem Weiterbildung und lebenslanges Lernen angeboten. Misserfolge werden dabei individualisiert und die Dynamik von Unsicherheiten, Bildungsnachfrage und Entwertungen ständig neu befeuert. In ihrem Beitrag wirft Astrid Messerschmidt, ausgehend von der Feststellung, dass Weiterbildungspflicht zu einer Antwort auf nicht mehr gestellte Fragen der Legitimität organisierter Bildung wurde, ihren Blick auf einige dafür eingesetzte Mechanismen. Im Beitrag thematisiert die Autorin, wie Subjekte zur Selbsttätigkeit und Selbstkontrolle aktiviert werden und wie zwar Fragen der Heterogenität in die Weiterbildung Einzug gehalten haben, aber die Anerkennung von Differenz dennoch unterentwickelt bleibt und Diskriminierungen verstärkt oder neue hervorbringt. Kritische Blicke auf diese Vorgänge sieht die Autorin als einen ersten Weg, neoliberalen Strategien entgegenzutreten. Daniela Rothe gibt in ihrem Beitrag einen kleinen Einblick in ihre umfassende Erforschung von (bildungspolitischen) Strategien, mit denen das nutzen- und brauchbarkeitsorientierte Konzept des lebenslangen Lernens in den öffentlichen Diskursen und den Köpfen der Menschen verankert wurde. Neben europaweiten und deutschen Strategien erweitert die Autorin in diesem Beitrag ihren Blick auf österreichische Entwicklungen. Der Beitrag zeigt auf, inwiefern durch bildungspolitische Dokumente, öffentliche Sprache und Themen und spezifische Begriffe lebenslanges Lernen zu einer umfassend akzeptierten Antwort avancieren konnte. Ebenfalls um das lebenslange Lernen aus diskursanalytischer Perspektive dreht sich der Beitrag von Ulla Klingovsky und Susanne Pawlewicz. Hier wird herausgearbeitet, in welchem Ausmaß lebenslanges Lernen eine bildungspolitische Strategie repräsentiert und nicht bildungstheoretischen Reflexionen entspringt. Die Entwicklungslinien des lebenslangen Lernens nachzeichnend umreißen die Autorinnen, inwiefern lebenslanges Lernen als bildungspolitische Antwort auf bestimmte Problembeschreibungen gelesen werden kann, die empirisch z.B. auf die Machteffekte oder auf Risse und Brüche zu untersuchen wären. Die Autorinnen entwerfen Ansätze, die versteckten Funktionen lebenslangen Lernens aufschlüsseln und ihnen bildungstheoretische und –wissenschaftliche Reflexionen entgegensetzen. Der nächste Beitrag wurde von einer Gruppe von Frauen des Vereins „maiz“ gemeinsam verfasst. Sie stellen dabei die von ihnen initiierte „Universität der Ignorant_innen“ vor, die als Strategie gegen eine „Vernutzung“ von Bildung und als Widerstand gegen das lebenslange Lernen konzipiert ist. Es geht um neue Formen der Produktion und Vermittlung von Wissen, die nicht exklusiv und elitär sein sollen. Die Tätigkeiten des autonomen Vereins der letzten zwanzig Jahre werden im Beitrag gestreift und Aktivitäten konzipiert, die zur Utopie einer gemeinsamen Produktion gegenhegemonialen Wissens beitragen sollen. Die Wahrnehmung zunehmender esoterischer Inhalte und Kursformate in der Erwachsenen- und Weiterbildung nimmt Erich Ribolits zum Anlass, diese Tendenzen nicht nur aufzuzeigen, sondern auch nach Begründungen zu suchen, die er in erster Linie in gesellschaftlich hervorgebrachten, zunehmenden Unsicherheiten verortet. Ansätze, die sich auf eine nicht begründbare, nicht sichtbare höhere Macht berufen, sieht der Autor in eklatantem Widerspruch zu Grundgedanken und einem Bildungsbegriff der Aufklärung, wodurch Bildung systematisch untergraben wird. In der abschließenden Besprechung des Buches „Bourdieu und die Frankfurter Schule“ beschreibt Ingolf Erler die von den Autor_innen formulierten vielfältigen Abgrenzungen, Übergänge, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwei kritischen Theorierichtungen in Frankreich und Deutschland. Das kommende schulheft Nr. 157 widmet sich dem Thema „Bildungsdünkel“ und damit den Formen von Beschämung und Diskriminierung in Bildungsprozessen, aber auch den Bewältigungsstrategien der Betroffenen dagegen. Ingolf Erler, Daniela Holzer, Christian Kloyber, Walter Schuster, Stefan Vater 1 Diese Übersetzung wurde unterstützt von Knowledgebase Erwachsenenbildung www.adulteducation.at Ingolf Erler, Mag., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung Wilhelm Filla, Dr., Univ.-Doz., Weiterbildungsforscher, Lehrbeauftragter an der Universität Klagenfurt, Aufsichtsratsmitglied der VHS Stuttgart Daniela Holzer, Dr.in, Assistenzprofessorin im Fachbereich Weiterbildung des Instituts für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universität Graz Ulla Klingovsky, Dr.in, Vertretung der Professur Erwachsenenbildung/ betriebliche und arbeitsmarktbezogene Weiterbildung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg maiz Frauen*, maiz – autonomes Zentrum von für Migrantinnen, Linz; unabhängiger Verein von und für Migrantinnen mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitssituation von Migrantinnen in Österreich zu verbessern und ihre politische und kulturelle Partizipation zu fördern sowie eine Veränderung der bestehenden, ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewirken (www.maiz.at) Peter McLaren, Prof. Dr., emeritierter Professor an der UCLA, Los Angeles, Ehrenprofessur für Kritische Studien an der Chapman Universität, zahlreiche internationale Preise, Ehren- und Gastprofessuren. Astrid Messerschmidt, Prof. Dr., Professorin für Interkulturelle Pädagogik/Lebenslange Bildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Gastprofessorin für Gender und Diversity an der Technischen Universität Darmstadt. Susanne Pawlewicz, studentische Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung an der TU Darmstadt Erich, Ribolits, Univ.-Prof. Dr., Privatdozent an den Universitäten Wien, Graz und Klagenfurt, bis 2008 Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien Daniela Rothe, Dip.-Päd.in Dr.in, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Bildung und Beratung im Lebenslauf am Institut für Bildungswissenschaft der Universität WienKlappentext

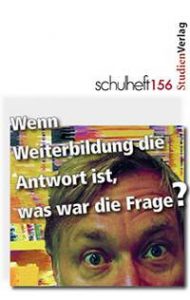 Von Arbeitslosigkeit, unternehmerischem Wettbewerb, subjektivem Leiden an gesellschaftlichen Verhältnissen bis hin zu gesundheitlichen oder ökologischen Fragen: Weiterbildung wird für viele gesellschaftliche Probleme als Lösungsweg gesehen. Die AutorInnen drehen diesen Automatismus um und fragen sich: „Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?“
Von Arbeitslosigkeit, unternehmerischem Wettbewerb, subjektivem Leiden an gesellschaftlichen Verhältnissen bis hin zu gesundheitlichen oder ökologischen Fragen: Weiterbildung wird für viele gesellschaftliche Probleme als Lösungsweg gesehen. Die AutorInnen drehen diesen Automatismus um und fragen sich: „Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?“
Es wird aber auch nach kritischen Alternativen Ausschau gehalten.Inhalt
Eine marxistische Epistel an die transnationale kapitalistische Klasse
Kritische Erwachsenenbildung – Kritik in der Erwachsenenbildung
Weiterbildung ist die falsche Antwort auf falsche Fragen
Erwachsenenbildung in Zeiten der Unsicherheit
Heterogenität statt Ungleichheit?
Diskursive Strategien in der Etablierung „Lebenslangen Lernens“
Untiefen im Diskurs um das LLL
Universität der Ignorant_innen
Das zunehmende Umsichgreifen der Esoterik in der ErwachsenenbildungVorwort
AutorInnen
Bestellen