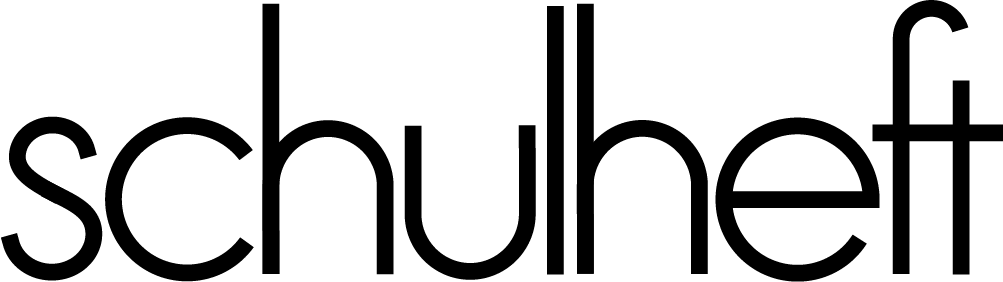Elternsprechtag – Über die Machtverhältnisse zwischen LehrerInnen und Eltern
Das vorliegende schulheft liefert Analysen zu den sprachlichen Codes und den sich darin manifestierenden Machtverhältnissen, zum Nicht zu Wort Kommen der „bildungsfernen Schichten“, zur Problematik des Norbert Kutalek ist tot! Editorial Gerold Scholz Helga Kotthoff Christine Machreich, Milli Bitterli Barbara Falkinger Heidemarie Brosche Christine Nöstlinger Florian Bergmaier Claudia Leditzky AutorInnen Der Begriff Eltern-„Sprechtag“ muss geklärt werden. Er ist verwandt mit der „Sprechstunde“, jenen Stunden oder Tagen, an denen „Parteienverkehr“ stattfindet, an denen also die (bittstellenden) BürgerInnen oder KundInnen oder PatientInnen ihre Anliegen der Behörde oder dem Arzt vortragen dürfen. Ohne das weiter zu erläutern, wollen wir die Hierarchie herausarbeiten, die zwischen den beiden herrscht, jenem, der die Sprechstunde „hält“, und jenem, der sie „besucht“. Zwischen LehrerInnen und Eltern, zwischen Schule und Familie herrscht genau diese Hierarchie. Darin spiegelt sich das Verhältnis zwischen Staat und Familie. So sehr viele in der Familie die „Keimzelle“ des Staates sehen, ist es doch umgekehrt: Der Staat sorgt für die Regeln, denen sich die Familien unterzuordnen haben. Beim amerikanischen Soziologen Talcott Parsons (in seinem grundlegenden Aufsatz: Die Schulklasse als soziales System, 19591) heißt das dann so: Die Schule vertritt ein Normen- und Wertesystem, das eine Stufe höher liegt als jenes der Familie. Er meint, dass die Schule universalistische Werte vertritt, also allgemeingültige, während die Familie partikularistisch orientiert ist, also an das (eigene) Kind denkt. (Wir kommen dazu später noch einmal.) Dieses „höherwertige“ Normensystem der Schule rechtfertigt offensichtlich die klare Machtverteilung zugunsten der Schule und der LehrerInnen. Diese einseitige Machtverteilung funktioniert sogar dann, wenn der Gesetzgeber den Eltern ausdrücklich ein Mitbestimmungsrecht einräumt; konkret z.B. bei der Schulbuchaktion: Diese wird bekanntlich aus dem Familienlastenausgleichsfonds finanziert, also nicht aus dem Budget des Unterrichtsministeriums. Deswegen sehen die entsprechenden Bestimmungen ein Recht zur Stellungnahme und ein Recht auf Mitentscheidung der Eltern bei der Wahl der Unterrichtsmittel vor (§ 61 SchUG). Allerdings können wir ganz sicher sein, dass dieses Recht kaum genutzt wird. Wie auch! Diese einseitige Machtverteilung dreht sich allerdings in dem Moment um bzw. wird in Frage gestellt, wenn Eltern mit größerem kulturellen Kapital in Erscheinung treten. Da machen dann manche LehrerInnen ganz brav „Kusch!“ Z.B. recherchierten Studierende der PH Wien – im 3. Semester wird die Lehrer-Eltern-Kommunikation zum Gegenstand eines soziologischen Seminars; und die Studierenden machen dabei einschlägige Erhebungen an Schulen –, dass eine VS-Lehrerin, die von einem Vater, sagen wir, er war Anwalt, ziemlich massiv unter Druck gesetzt wurde, schließlich doch den 2er in Deutsch gegeben hat, der für die AHS-Reife notwendig war, nachdem sie ursprünglich einen 3er geben wollte. Und man kann es ihr nicht verdenken! Bevor sie „gröbere“ und langfristig wirksame „Wickel“ riskiert?! Diese Machtverhältnisse zwischen LehrerInnen und Eltern, und wie sie sich mit Eltern (und LehrerInnen) unterschiedlicher sozialer Herkunft und mit unterschiedlicher Ausstattung an kulturellem Kapital konkret ausgestalten, das ist das Thema dieses schulhefts. Wir können da zwei Thesen formulieren: These 1: Wenn Eltern in der Schule – tatsächlich! – zu Wort kommen, dann sind es wohl eher Eltern mit großem kulturellen Kapital. These 2: Diese Eltern benutzen ihr Wort natürlich partikularistisch (s.o. Parsons); aber nicht nur partikularistisch im Sinne des eigenen Kindes, sondern wohl auch partikularistisch im Sinne der eigenen Klasseninteressen, also im Interesse der bildungsaffinen Mittelschichten. Aufschlussreich ist dabei die Beobachtung, dass Mittelschicht-Eltern mit großem kulturellen Kapital manchmal doch den Mund halten; nämlich dann, wenn es dem eigenen Kind schaden könnte. (Da beißen sich manche fast die Zunge blutig, weil man gegenüber LehrerInnen sehr vieles n i c h t sagt, was man sagen möchte und was man anderen sehr wohl sagen würde. Das berühmte Argument: Wenn ich mich da jetzt aufreg, schadet es ja nur meinem Kind!) Wer in der Schule normalerweise überhaupt nicht zu Wort kommt, sind die Eltern aus den sogenannten „bildungsfernen Milieus“. Wohl auch deshalb, weil ihnen die Worte fehlen, sei es, weil sie der deutschen Sprache nicht (so) mächtig sind, sei es, weil sie wissen, dass ihre Sprache in der Schule nicht gesprochen wird. (So spricht man nicht!) Als Illustration für dieses „(Noch immer) nicht zu Wort Kommen“ haben wir uns entschlossen, ein jetzt schon 40 Jahre altes Gedicht von Christine Nöstlinger abzudrucken: „de guatn und de aundan“. Selbstkritisch haben wir anzumerken, dass es uns, trotz mehrmaliger Anläufe in den Redaktionssitzungen, nicht gelungen ist, die Stimme der „aundan“ lauter zu Wort kommen zu lassen als mit diesem Gedicht von Christine Nöstlinger. Zu den (weiteren) Beiträgen: Gerold Scholz analysiert die „Verkehrsformen zwischen Elternhaus und Schule“ und illustriert die oben formulierten Thesen von der Dominanz der Schule (These 1) und vom fintenreichen Spiel mit dem Bildungskapital (These 2) mit umfangreichem Material aus seiner langjährigen Tätigkeit als Grundschulforscher. Helga Kotthoffs Beitrag „Faul wie e Hund. Kritische Eltern in der schulischen Sprechstunde“ liefert aufschlussreiche Einsichten in die Kommunikationsstrategien von Eltern, die sich in die Sprechstunden von LehrerInnen begeben. Mit der im Titel angedeuteten Übertreibungs- bzw. Anklagestrategie (Faul wie e Hund) dokumentieren die Eltern, so die Ergebnisse von Kotthoffs Forschungen, ihr einschlägiges Bildungskapital und begeben sich dadurch mit den LehrerInnen „auf Augenhöhe“. Es gibt allerdings eine Gruppe, der diese Strategie nicht zur Verfügung steht: die Sonderschul-Eltern. Einen interessanten Briefwechsel, der aus einer Seminararbeit über die Machtverhältnisse zwischen LehrerInnen und Eltern und ihren sprachlichen Ausdrucksformen entstanden ist, liefern Christine Machreich und Milli Bitterli. Die beiden ehemaligen Studierenden der PH sind inzwischen selbst (Volksschul)Lehrerinnen und befinden sich damit in der gar nicht so komfortablen Situation, ihre theoretischen Überlegungen bzw. ihre Interpretationen der Aussagen aus den Interviews „am lebenden Subjekt“ überprüfen zu können. Interessant ist die unterschiedliche Sicht der beiden Autorinnen auf das Machtgefälle zwischen LehrerInnen und Eltern. Machreich argumentiert mit Bourdieu und stellt das sprachliche und kulturelle Kapital in den Vordergrund. Bitterli reflektiert auf die „Amtsautorität“ der LehrerInnen, auf die institutionelle Seite der Macht. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Fallstricke der Lehrer-Eltern-Kommunikation liefert Barbara Falkinger mit einem „Klassiker“ in dieser Beziehung: dem Du-Wort zwischen Lehrerin und Eltern. Die Komplikation mit bildungsfernen Eltern mit Migrationshintergrund ist quasi vorprogrammiert. Eine Art Verteidigungsrede der Eltern von „Schantall“, Kevin, Jasmin, und wie die Kinder sonst noch heißen mögen2, liefert Heidemarie Brosche, die sich ein bissl für die vorurteilsbeladene Sprache ihrer KollegInnen in den Lehrerzimmern geniert. An dieser Stelle haben wir das schon angesprochene Gedicht von Christine Nöstlinger abgedruckt, um den in Brosches Beitrag angesprochenen Graben zwischen „den guatn und den aundan“ wenigstens einmal von der anderen Seite zu beleuchten. Der Beitrag von Florian Bergmaier „Vom KEL- Gespräch zum Mitarbeiter_innengespräch Oder: Kinder als Mitarbeiter_innen im Unternehmen Schule?“ nimmt sich eine neue Variante der neoliberalen Unternehmensphilosophie vor, der sich die Schule zu unterwerfen hat: Er zieht frappierende Parallelen zwischen dem (in Unternehmen üblichen) MitarbeiterInnen-Gespräch und dem mit dem Schuljahr 2012/13 eingeführten KEL-Gesprächen (Kinder-Eltern-Lehrer-Gesprächen). Im letzten Beitrag liefert Claudia Leditzky einen Einblick in die Praxis der LehrerInnenbildung: „Kommunikation in Theorie und Praxis – ein Baustein in der Lehrer/innenausbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien“. Hier geht es um die Kongruenz von Theorie und Praxis bzw. um die Frage, ob es beim Thema Kommunikation nicht auch um ein praktisches Wissen, also ein praktisch zu erwerbendes Können geht. Die Redaktion 1 Parsons, T.: Die Schulklasse als soziales System: Einige ihrer Funktionen in der amerikanischen Gesellschaft. X-fach abgedruckt; z.B. in Bauer, U.; Bittlingmayer, U.H.; Scherr, A. (Hg) (2012): Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie. Wiesbaden: Springer VS, S. 103–124. 2 Vgl. dazu die Bachelor-Arbeit von Maria Glaw: Der Kevin-Effekt: Vornamen als Indikator für das soziale Milieu. Saarbrücken: Akademikerverlag 2013. Bergmaier, Florian, Dipl.-Ing., BEd, Lehrer an einer Neuen Mittelschule in Wien Bitterli, Milli, seit 2012 Volksschullehrerin, davor Tänzerin, Tanzpädagogin, Kuratorin und Choreografin Brosche, Heidemarie, Hauptschullehrerin in der Nähe von Augsburg, schreibt Sachbücher, Kinderbücher und Jugendbücher Falkinger, Barbara, MA, Lehrerin in der Lerngemeinschaft 15 und Mediatorin in Wien Kotthoff, Helga, Univ.-Prof., Germanistin, Universität Freiburg Leditzky, Claudia, Mag., BEd, Studium der Pädagogik, Volksschullehramt, Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Wien in den Bereichen Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft sowie Persönlichkeitsbildung Machreich, Christine, Germanistin und Buchhändlerin, Volksschullehrerin in Wien Scholz, Gerold, Univ.-Prof. i.R., Erziehungswissenschafter; Universität Frankfurt/Main, Institut für Elementar- und PrimarschulpädagogikKlappentext

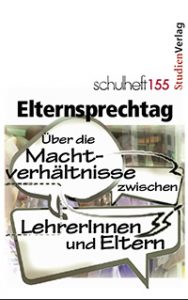 Die Verhältnisse zwischen LehrerInnen und Eltern sind schwierig. Es sind Machtverhältnisse, die den Akteuren oft gar nicht bewusst sind. Die Kommunikation läuft auch selten direkt, meist nur über die Kinder. Wenn es hin und wieder doch, z.B. an Elternabenden und Elternsprechtagen, zum direkten Austausch kommt, wird von beiden Seiten „taktiert“. Oft genug behindert die Sprache mehr, als dass sie den Austausch befördert.
Die Verhältnisse zwischen LehrerInnen und Eltern sind schwierig. Es sind Machtverhältnisse, die den Akteuren oft gar nicht bewusst sind. Die Kommunikation läuft auch selten direkt, meist nur über die Kinder. Wenn es hin und wieder doch, z.B. an Elternabenden und Elternsprechtagen, zum direkten Austausch kommt, wird von beiden Seiten „taktiert“. Oft genug behindert die Sprache mehr, als dass sie den Austausch befördert.
„Lernens von Kommunikation“ in der LehrerInnenbildung und zu neueren Entwicklungen wie den KEL-Gesprächen,
die man als weiteren Schritt in der Neoliberalisierung der Schule sehen kann.Inhalt
Verkehrsformen zwischen Elternhaus und Schule
Faul wie e Hund
Kritische Eltern in der schulischen Sprechstunde
Die Sprache der LehrerInnen.
Die Sprache der Eltern.
Die Machtverhältnisse.
Ein Briefwechsel
Wir sind per DU!
Schantall in der Schule
Bildungsbürgertum versus Prekariat
De guatn und de aundan
Vom KEL-Gespräch zum Mitarbeiter_innengespräch
Oder: Kinder als Mitarbeiter_innen im „Unternehmen“ Schule?
Kommunikation in Theorie und Praxis – ein Baustein in der Ausbildung angehender Lehrer/innen an der Pädagogischen Hochschule WienVorwort
AutorInnen
http://www.h-brosche.de
http://portal.uni-freiburg.de/sdd/personen/kotthoff/index.html/startseite
http://www1.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/scholz.htmlBestellen