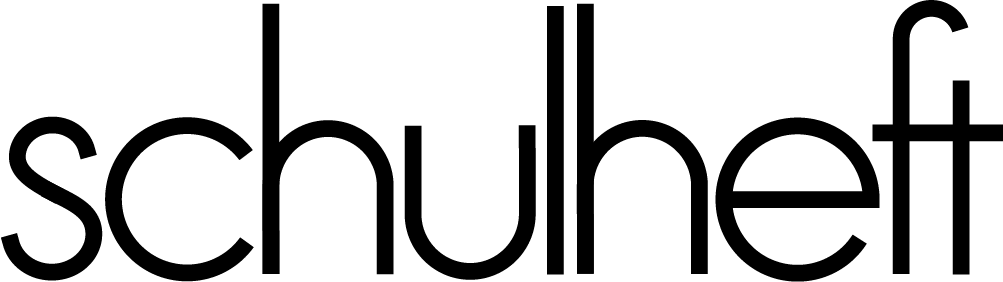Das Ende der Schule, so wie wir sie kennen
Klappentext Informationstechnologische Revolution, ökonomische Globalisierung und krisenhafte Entwicklung des Kapitalismus leiten gegenwärtig einen tiefgreifenden Wandel der gesellschaftlichen Orientierung und der korrelierenden Erwartungen an die Gesellschaftssubjekte ein. Im vorliegenden schulheft werden schlaglichtartig Veränderungen in der inneren und äußeren Organisation von Schule am Übergang von einer disziplinargesellschaftlichen zu einer kontrollgesellschaftlichen Institution thematisiert. Vorwort Tobias DörlerÜber den Zwang, mit Selbstkontrolle die eigene Freiheit zu erhalten.Oder: Umgang von Lehrer/innen mit Fremd- und Selbstansprüchen. Stefan T. Hopmann & Mariella Knapp Eveline Christof Barbara Schratz & Michael Schratz Agnieszka Czejkowska Monika Hofer Johanna F. Schwarz Sabine Gerhartz-Reiter Julia Köhler Eva Sattlberger Katharina Rosenberger Michael Sertl Autor/innen Hintergrund des angesprochenen Veränderungspostulats ist ein durch informationstechnologische Revolution, ökonomische Globalisierung und krisenhafte Entwicklung des Kapitalismus bedingter, rasch voranschreitender gesellschaftlicher Umbruch. Der gesellschaftliche Umbau, von dem immer offensichtlicher wird, dass er weit über die übliche gesellschaftliche Dynamik hinausgeht, wird verschiedentlich als Übergang von einer Disziplinargesellschaft zu einer Kontrollgesellschaft charakterisiert. Gemeint ist damit, dass aktuell ein Wandel der Form stattfindet wie Menschen dazu gebracht werden, der gesellschaftlichen Verfasstheit grundsätzlich positiv gegenüberzustehen und ein Verhalten auszubilden, das dieser entspricht. Bisher waren es ihre Einbindung in sogenannte Einschließungsmilieus (Kleinfamilie, Schule, Fabrik, Militär, …) und die dort wirkenden Hierarchien und Disziplinierungsmechanismen, durch die sie gelernt hatten, dem Status quo entsprechende Normalitätsvorstellungen von Mensch und Gesellschaft zu entwickeln und sich korrelierend zu verhalten. Nun geschieht dies immer mehr durch eine die Gesellschaft prägende, permanente, unterschwellige Kontrolle, verbunden mit dem Effekt, dass es eines durch Autoritätspersonen ausgeübten Disziplinardrucks, um Menschen zum gewünschten Verhalten zu bringen, nicht mehr bedarf. Ein sich bei den Individuen gegenwärtig nach und nach ausbildendes Bewusstsein ihrer permanenten Kontrollierbarkeit bewirkt, dass sie aus eigenem Antrieb an ihrer Selbstoptimierung im Sinne der Erfolgskriterien im allgemeinen Konkurrenzkampf arbeiten. In der Disziplinargesellschaft war es – um angemessen über die Runden zu kommen – vor allem erforderlich gewesen, jene (Sekundär)Tugenden auszubilden, die dem bürgerlichen Kapitalismus zum Durchbruch verholfen haben. Zu den „Merkmalen des disziplinierten Subjekts“ zählten (und zählen in abnehmendem Maß in der gegenwärtigen Übergangsphase zur Kontrollgesellschaft selbstverständlich auch heute noch) primär Ordnung, Sauberkeit, Fleiß, Beständigkeit, Pünktlichkeit, Gehorsamkeit und Selbstbeherrschung. Das Bezugsmodell der Disziplinargesellschaft – die Fabrik – setzt das friktionsfreie Zusammenwirken problemlos funktionierender „Rädchen im Getriebe“ voraus. Dementsprechend ging es in den gesellschaftlichen Bereichen, in denen die Transformation der Individuen zu disziplinierten Subjekten passierte – den Einschließungsmilieus der Industriegesellschaft – stets um das Herstellen des optimal an gesellschaftlich-ökonomische Vorgaben angepassten und somit hinsichtlich seiner Verwertbarkeit abschätzbaren, letztendlich somit „berechenbaren“ Menschen. Ziel war die „disziplinierte Arbeitskraft“, die sich durch hohes Arbeitsethos, ein veritables Maß an Autoritätshörigkeit sowie die Bereitschaft auszeichnet, sich weitgehend kritiklos im Rahmen eines hierarchischen Systems „nützlich zu machen“, und die darüber hinaus auch überzeugt ist, (nur) für eine bestimmte Position der gesellschaftlichen Hierarchie „begabt“ zu sein. Seitdem die allgemeine Lernpflicht für Heranwachsende eingeführt worden war, war es in diesem Sinn eine ganz wichtige Funktion der Schule, die ihr Anvertrauten zum Akzeptieren der sozialen Hierarchie zu bringen, indem sie lernen, Erfolg oder Versagen als individuell mehr oder weniger gegebene Leistungsfähigkeit und -willigkeit zu interpretieren. Die Schule ist ein Kind der Disziplinargesellschaft – als eine Einrichtung, die alle Heranwachsenden gleichermaßen durchlaufen müssen, war sie von Anfang an dafür da, durch die ihr verliehene Disziplinarmacht die Steigerung der Kräfte der ihr Anvertrauten für die Zwecke der Verwertung ihrer Arbeitskraft bei gleichzeitiger Domestizierung ihrer machtkritischen Potenz zu bewirken. Der nunmehrige gesellschaftliche Umbruch in Richtung Kontrollgesellschaft zwingt die Schule allerdings, von ihrer bisherigen Orientierung an „Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit“ abzugehen und Strukturen bereitzustellen, die dafür geeignet sind, dass Heranwachsende die von ihnen erwarteten Fähigkeiten und Verhaltensweisen weitgehend eigenständig auszubilden lernen. Denn heute reicht die bisher antrainierte „Bereitschaft zur Brauchbarkeit“, verbunden mit dem weitgehenden Akzeptieren der qua Erstausbildung zugewiesenen Position, immer weniger, um sich im aktuell herausbildenden kontrollgesellschaftlichen Modus zu bewähren. Bedingt durch die technologische Substituierbarkeit menschlicher Arbeitskraft in einem bisher noch nie dagewesenen Umfang ist der Kapitalismus in eine neue Phase seiner Entwicklung getreten. Die Zeiten, die von einer permanenten Expansion der Verwertung von Arbeitskräften gekennzeichnet waren, sind vorbei, in seiner nunmehrigen „neoliberalen“ Variante (über)lebt der Kapitalismus durch die Intensivierung der Verwertung. Die Ausbeutung jener Fähigkeiten von Menschen, die in traditionellen schulischen Settings lehr- und lernbar sind, wird den Verwertungserfordernissen zunehmend nicht mehr gerecht, nun gilt es, Menschen in einer wesentlich ganzheitlicheren Form für das System zu vereinnahmen. Es geht darum, ihren Einfallsreichtum, ihre Kritikfähigkeit, ihre Lust am Spiel, ihre schöpferischen Fähigkeiten, ihre Kommunikationsfreudigkeit, …, kurzum, den vollen Umfang ihres menschlichen Potentials zu mobilisieren. Der durch Informations- und Kommunikationstechnologie möglich (und im Sinne des dem System innewohnenden Verwertungszwangs auch notwendig) gewordenen Ausprägungsform der Kapitalverwertung ist die bürgerliche Spielart des Kapitalismus nicht mehr adäquat; zunehmend bildet sich ein „nachbürgerlich politisch-ökonomisches System“ heraus, dem die bürgerlich-disziplinierte Haltung als Arbeitskraft obsolet ist. In diesem nachbürgerlichen Kapitalismus stellt es letztendlich ein Verwertungshandicap dar, in Form von diszipliniertem, vorgabengemäßem Verhalten bloß die „Bereitschaft“ zu signalisieren, sich als Arbeitskraft brav verwerten lassen zu wollen, „das wirkliche Leben“ aber außerhalb der Verwertungssphäre anzusiedeln. Um erfolgreich über die Runden kommen und sich „gegen die Konkurrenz behaupten“ zu können, gilt es, die eigene Verwertung nunmehr mit ungebremstem Engagement und intrinsischer Motivation „autonom“ zu organisieren. Dem neuen Gesellschaftsregime entspricht nur, wer bereit ist, sich – lebenslang – als „Unternehmer seiner selbst“ zu begreifen und einen Sozialcharakter auszubilden, der konsequent an der Performance am Markt ausgerichtet ist. Letztendlich heißt das, alles – Dinge, Personen, Beziehungen, … und vor allem eben auch sich selbst – nur mehr im Fokus des (Markt)Werts wahrzunehmen. Erfolgreich zu sein bedeutet, sich dem Prokrustesbett der Warenförmigkeit optimal anzupassen – nur wer „etwas aus sich macht“ und am Markt erfolgreich ist, ist etwas wert. Es gilt, den Markt als jene – gottgleiche – Instanz anzuerkennen, der es ständig zu dienen gilt, indem man sich als erfolgreicher Manager bei der Vermarktung des Humankapitals erweist, als das man sich voll und ganz empfindet. Dazu ist nicht nur eine gegenüber bisherigen Orientierungen grundsätzlich andere Selbstwahrnehmung und Interpretation der Welt erforderlich, es ist vor allem notwendig, sich als permanent in Konkurrenz stehend zu begreifen. Es gilt, das Motto zu verinnerlichen: Du bist dir selbst der Nächste und jeder andere ist letztendlich dein Gegner. Während sich die erfolgversprechenden „Persönlichkeitseigenschaften“ in der zu Ende gehenden Disziplinargesellschaft als das „Unterwerfen unter die Not, die eigene Haut zu Markte tragen zu müssen“ zusammenfassen lassen, lässt sich die an Menschen unter den Bedingungen der heraufdämmernden Kontrollgesellschaft hinsichtlich ihres Charakters herangetragene Forderung als die „Identifikation mit ihrer Vermarktung“ beschreiben. Es geht nicht mehr bloß um die der Überlebensnotwendigkeit geschuldete Bereitschaft, als Ware zu fungieren, sondern um ein diesbezüglich „autonom“ hervorgebrachtes Engagement. Im Korsett der bedingungslosen Akzeptanz der Verwertungsprämisse gilt es nun, Charaktereigenschaften wie Flexibilität, Mobilität, Eigenverantwortlichkeit und Selbstführung zu entwickeln. Alle dem Menschen innewohnenden Potentiale zur Gestaltung der Welt sollen für die Verwertung aktiviert werden. Das nachbürgerliche Subjekt unterliegt dem „Diktat fortwährender Selbstoptimierung“ im Sinne eines permanenten Bemühens, seine Marktchancen zu verbessern. Die Vorstellung, als Subjekt selbst Ware zu sein, die einer andauernden Kontrolle hinsichtlich ihres Marktwerts unterliegt, verhindert, dass die solcherart freigesetzten Potentiale der Menschen dem Marktgott gegenüber skeptisch werden und sie sich dem „Gottesdienst der Verwertung“ verweigern. Die skizzierte Ablösung der Disziplinar- durch die Kontrollgesellschaft und der damit einhergehende Druck auf die Angehörigen der Gesellschaft, eine veränderte Selbstwahrnehmung und Weltsicht auszubilden, impliziert einen massiven Veränderungsdruck für die Schule. Als eine Einrichtung, die alle Heranwachsenden gleichermaßen durchlaufen müssen, ist sie parallel mit der Disziplinargesellschaft entstanden und hinsichtlich ihres Selbstverständnisses mit dieser wie die zwei Seiten einer Münze verbunden. Die Schule war von Anfang an dafür da, die Steigerung der Kräfte der Massen für die Zwecke der Verwertung ihrer Arbeitskraft bei gleichzeitiger Domestizierung der machtkritischen Potenz der Subjekte zu bewirken. Und ihre Bedeutung war diesbezüglich immer auch besonders hoch, da sich ihre disziplinierende Wirkung über einen großen Teil jener Phase im Leben eines Menschen erstreckt, in der dieser für Prägungen besonders empfänglich ist. Im Sinne ihre Funktion als disziplinargesellschaftliche Zentraleinrichtung stand die „Erziehung zu Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit“ in der Schule immer an vorderster Stelle – ihre gesamte Organisation und innere Struktur ist letztendlich Ausdruck dieser Ausrichtung, und durch sie wurde auch das Selbstverständnis der schulischen Hauptakteure, der Lehrerinnen und Lehrer, seit den ersten Ansätzen ihrer Professionalisierung in seinen Grundfesten bestimmt. Um auch in der Kontrollgesellschaft bei der Formierung des Gesellschaftscharakters eine tragende Rolle zu spielen, steht die Schule somit vor der Notwendigkeit, sich in ihrer inneren und äußeren Struktur grundsätzlich zu verändern. In letzter Konsequenz muss sie den in allen Aspekten bestimmenden Charakter als Institution des disziplinierenden Zugriffs und die damit verbundene Orientierung an der weitgehend „blind“ funktionierenden Arbeitskraft überwinden und zu einer Einrichtung werden, die – konträr zu ihrer bisherigen Ausrichtung – der Förderung der – der eigenen Verwertung selbstverantwortlich und bewusst-positiv gegenüberstehenden – unternehmerischen Persönlichkeit verschrieben ist. Schule muss sich von einer Einrichtung, die mit Begriffen wie Disziplin, Kontrolle, Lenkung, Einschränkung … verbunden ist, zu einer wandeln, die mit dem kontrollgesellschaftlichen Mythos der (Wahl)Freiheit korreliert. Im skizzierten Sinn geht es im gegenständlichen schulheft darum, bereits stattgefundene und sich am Horizont abzeichnende weitere Veränderungen in der inneren und äußeren Organisation der Schule dahingehend zu hinterfragen, in welcher Form dadurch ihre Umgestaltung von einer disziplinargesellschaftlichen Zentralagentur zu einer Einrichtung vorangetrieben wird, durch die „Unternehmer ihrer selbst“ hervorgebracht werden sollen. Zu diesem Zweck werden in den vorliegenden Beiträgen insbesondere Veränderungen der Unterrichtsorganisation, die Rolle der Lehrer/innen sowie ihrer Qualifizierung, Beurteilungsformen oder Ansätze einer veränderten Strukturierung des Schulwesens in den Fokus genommen. Eveline Christof & Erich Ribolits Redaktion Eveline Christof AutorInnen Ass.-Prof. Mag. Dr. Eveline Christof ist stellvertretende Leiterin des Instituts für LehrerInnenbildung und Schulforschung an der School of Education der Universität Innsbruck. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind LehrerInnenbildung, reflexionswissenschaftliche Forschung, qualitative Bildungsforschung. Univ.-Prof. Dr. Agnieszka Czejkowska ist Leiterin des Instituts für Pädagogische Professionalisierung der Universität Graz. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte umfassen die Themenkomplexe Kritische Professionstheorien und Differenz in Vermittlungsprozessen sowie Ästhetische Bildungsforschung. Sie ist Hochschulrätin der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland, Herausgeberin der Buchreihe Arts & Culture & Education sowie des Jahrbuchs für Pädagogik. Mag. Tobias Dörler ist Universitätsassistent am Institut für Pädagogische Professionalisierung der Universität Graz mit den Arbeitsschwerpunkten kritische Schulentwicklung, systemische Grundlagen für pädagogische Professionalisierungsprozesse, sowie Handlungs(spiel)räume im Bildungswesen. Zudem unterrichtet er an der HBLA Herbststraße Wien im Fachbereich Kunst. MMag. Sabine Gerhartz-Reiter BA PhD ist Senior Lecturer am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung an der School of Education der Universität Innsbruck. Sie forscht im Bereich der Schulforschung zu den Themen Ungleichheit im Bildungssystem, Bildungskarrieren und Strukturen im Schulsystem. Mag. Monika Hofer MA arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Baden und ist Lehrende an der Universität Wien und Universität für Bodenkultur Wien. Sie schreibt derzeit an einer Dissertation zum Thema Wege der Professionalisierung in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Univ.-Prof. Dr. Stefan Hopmann MA ist Professor am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Vergleichende Untersuchungen zur Lehrplan- und Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung in Bildungs- und anderen sozialen Systemen sowie historisch-vergleichende Didaktik. Mag. Mariella Knapp ist Assistentin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind quantitativ-empirische Bildungsforschung, Bildungsübertrittsforschung am Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I sowie International-vergleichende Bildungsforschung. Mag. Julia Köhler ist Lehrende an der Universität Wien und an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen im Bereich der LehrerInnenbildung. Sie arbeitet derzeit an einer Dissertation im Bereich der LehrerInnenbildungsforschung zum Thema Reflexion durch theatrale Wege. MMga. Cathrin Reisenauer ist Senior Lecturer am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung an der School of Education der Universität Innsbruck. Derzeit arbeitet sie an einer Dissertation im Bereich der Schulforschung. Univ.-Prof. Dr. Erich Ribolits ist Privatdozent an verschiedenen österreichischen Universitäten und ehemaliger Leiter der Abteilung für Aus- und Weiterbildung am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen kritische Bildungstheorie, den Zusammenhang zwischen Bildung und Gesellschaft und zwischen Bildung und Arbeit. Mag. Dr. Katharina Rosenberger ist an der Pädagogischen Hochschule Wien Krems beschäftigt. Sie forscht zu den Themen Bildung und Raum sowie zu Praxistheorien. Mag. Dr. Eva Sattlberger BIFIE Wien, Teamleitung für die standardisierte schriftliche Reifeprüfung Mathematik (AHS), AHS Lehrerin (Physik und Mathematik), Publikationen zur Didaktik der Mathematik und im Bereich Ausbildung von Betreuungslehrer/innen, Schulbuchautorin Dr.phil Michel Sertl, Soziologe, ehemaliger Hauptschullehrer, PH Wien (seit 2014 in Ruhestand). Forschungsschwerpunkte: Schule und soziale Ungleichheit, Soziologie der Schule und des Unterrichts. Mag. Dr. Barbara Schratz ist Mitarbeiterin des Zentrums für Lernende Schulen, welches österreichweit die Einführung der NMS begleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Resilienzforschung. Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Schratz ist Dekan der School of Education der Universität Innsbruck. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Schulentwicklung und Leadership. Mag. Dr. Johanna F. Schwarz MA hat derzeit ein Habilitationsstipendium an der Universität Innsbruck und schreibt ihre Habilitation zum Thema Zuschreibung als Phänomen des Pädagogischen Geschehens. Mag. Nadine Ulseß-Schurda ist Lehrerin am Gymnasium in der Au in Innsbruck. Sie arbeitet an einer Dissertation zum Thema Anerkennungsprozesse in der Schule. Studienverlag: Schulheft 160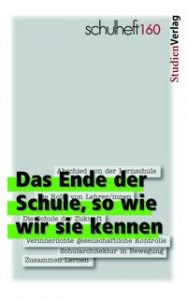 Das Ende der Schule, so wie wir sie kennen
Das Ende der Schule, so wie wir sie kennenInhalt
Cathrin Reisenauer & Nadine Ulseß-Schurda
Anmerkungen zur Leistung als Norm der Anerkennung in einer sich verändernden Gesellschaft
Die letzten Tage der Schule, wie wir sie kennen?
Der schulische Auftrag im Spannungsfeld zwischen Kultivieren und Qualifizieren
Die Rolle von Lehrer/innen – zwischen Macht und Ohnmacht
Abschied von der Lernschule: Schulentwicklung für Bildung
‚Zusammen lernen'
Schule entwickeln trotz Innovations- und Veränderungsrhetorik
Die Schule der Zukunft
Lehramtsstudierende reflektieren über pädagogische Ansprüche einer Schule von morgen
Grüßen als Geste schulischer Praxis
Von der Wirkmacht schulischer Lehr- und Lernerfahrungen
Verinnerlichte gesellschaftliche Kontrolle in Bildungskarrieren am Beispiel einer Studie zu Bildungsaufstieg und Bildungsausstieg
Die Kulturschule – ein Modell für die Zukunft?
Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung – eine Systemänderung mit Konsequenzen
Schularchitektur in Bewegung – die räumlich-materielle Seite schulischen Lernens
Eine neue Zeitschrift: Pädagogik und PolitikVorwort
AutorInnen
Erwin RibolitsBestellen