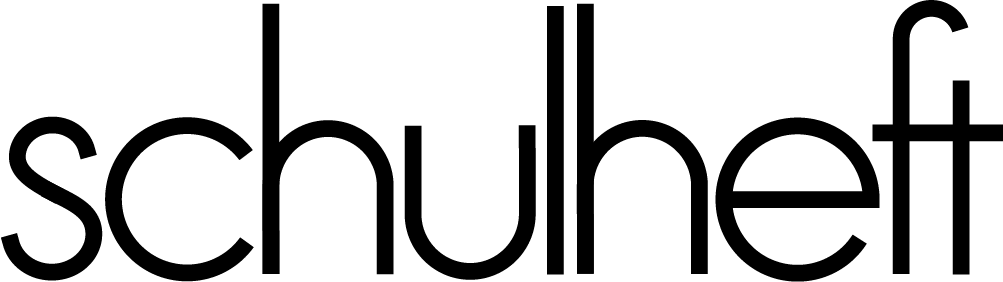Ein Blick in die Lebenssituation türkischer ÖsterreicherInnen
Mit Beiträgen von Sevgi Bardakci, Katharina Brizic, Barbara Falkinger, Hülya Hanci, Barbara Herzog-Punzenberger, Sonja Hinsch, Gamze Ongan, Andrea Partsch, Gerhard Petersdorfer, Michael Rittberger, Michael Sertl und Renee Winter. Mit Beiträgen von Sevgi Bardakci, Katharina Brizic, Barbara Falkinger, Hülya Hanci, Barbara Herzog-Punzenberger, Sonja Hinsch, Gamze Ongan, Andrea Partsch, Gerhard Petersdorfer, Michael Rittberger, Michael Sertl und Renee Winter. Barbara Herzog-Punzenberger Sonja Hinsch Michael Rittberger Sonja Hinsch Gamze Ongan Gerhard Petersdorfer Katharina Brizić Interview Hülya Hancı, Andrea Partsch Barbara Falkinger, Michael Rittberger Michael Sertl Renee Winter Sevgi Bardakçı Schüler und Schülerinnen: Vorurteile von Österreichern - Kinder mit Migrationshintergrund, damals noch "Gastarbeiter"-Kinder genannt, haben das schulheft von Anfang an beschäftigt (zum ersten Mal explizit 1982 in der Nr. 26/27). Ein LehrerInnen-Magazin, das sich als gesellschaftskritisch versteht, kommt um das Thema natürlich nicht herum, auch wenn es nicht immer offensichtlich und vordergründig darum geht. Manchmal taucht das Thema leicht "versteckt" auf: z.B. beim Teamteaching oder beim Förderunterricht usw. Explizit behandelt wurde es das letzte Mal im Jahr 2004 anlässlich der großen "gastarbajteri"-Ausstellung in Wien (s. SH 114). Mit und in dieser Ausstellung sahen wir ein neues Kapitel in der Migrationsgeschichte der Zweiten Republik aufgeschlagen. Zum ersten Mal wurde diese Geschichte aus der Perspektive der MigrantInnen dargestellt. Diesen Faden, diese neue Sichtweise, wollten wir in der vorliegenden Nummer wieder aufnehmen und - noch konsequenter! - zu Ende führen, indem wir VertreterInnen der MigrantInnen einladen wollten, dieses schulheft ganz aus ihrer Sicht zu gestalten. Hatten wir uns so gedacht! Wir mussten allerdings zur Kenntnis nehmen, dass unsere Intention zu wenig klar rüberkam - auf jeden Fall konnten wir außer einer türkischen Hauptschullehrerin niemanden wirklich zur Mitarbeit motivieren. Wir begannen Gründe dafür zu suchen und kamen langsam zu der Erkenntnis, dass der Begriff "Migration" zu allgemein und zu wenig präzise ist. Die Lebenswelten von Menschen/LehrerInnen/WissenschafterInnen mit "Migrationshintergrund" sind sehr vielfältig und unterschiedlich … und haben oft genug nicht (mehr) unmittelbar mit Migration zu tun. Trotzdem wollten wir den Anspruch nicht gleich aufgeben: Wir - als nicht-migrantische RedakteurInnen dieser Nummer - können eigentlich über die migrantischen Lebenswelten nicht wirklich mitreden. Wir sind in der Position des oder der mehr oder weniger empathisch Mitredenden, ohne selbst betroffen zu sein. (Eigentlich stellt das auch schon wieder eine "kolonisa6 torische" Überheblichkeit dar: Natürlich sind wir auch betroffen, aber anders, andersrum! "Wir Österreicher" sind die Nutznießer.) Diese zwei Gedanken, die Erkenntnis der zu geringen Treffgenauigkeit des Begriffs "Migration" und die Notwendigkeit, den kolonisatorischen Blick systematisch durch die authentische Sichtweise der Betroffenen zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen, hat uns bewogen, den Focus auf eine einzige Gruppe zu richten: auf die Türkinnen und Türken. Als Wiener Pfl ichtschullehrerInnen denken wir da gleich an Beobachtungen wie jene, dass türkische Kinder der 2. oder 3. Generation schlechter Deutsch können als ihre Eltern, oder dass sich Kinder vermehrt als TürkInnen fühlen, obwohl sie das Heimatland der Großeltern kaum kennen. Wir wollten uns also mit jener Gruppe beschäftigen, die publizistisch den meisten Staub aufwirbelt und gerne als "Problemgruppe" gesehen wird. Wir wollten also ein türkisches schulheft, ein "OKUL DEFTERI" machen. Wir wollen damit exemplarisch die Vielfalt einer "MigrantInnengruppe" zeigen, die Widersprüche, die Brüche und Kontinuitäten, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, den Generationen, den Ethnien, Kulturen und Sprachen usw. Wir wollen den Schwerpunkt auf die Lebenswelten der MigrantInnen aus EINEM Land legen. Gleichzeitig ist es aber auch der Versuch, anhand der Vielfalt der MigrantInnen EINES Staates darzustellen, welch fragwürdige Verallgemeinerung Bezeichnungen wie "die Migranten", "der Migrant" oder "die Migrantin" sind. Schließlich haben wir uns dafür entschieden, dem Ganzen einen Titel zu geben, der erst wieder die "Wir"-Perspektive repräsentiert: Dazugehören oder nicht!? Dabei ist das Dazugehören (zur österreichischen Bevölkerung) oder nicht eine zentrale Frage, die sicher nicht von Personen mit türkischem Migrationshintergrund alleine abhängt! Barbara Herzog-Punzenberger eröffnet daher unser schulheft mit der Fragestellung, welche Bedeutung das Dazugehören hat und wodurch es behindert wird. Sonja Hinsch liefert Zahlen zur Situation von Personen mit türkischem Migrationshintergrund und behandelt das Problem aus einer sozioökonomischen Perspektive. Michael Rittberger hat in der ‚Kronen Zeitung’ im Zeitraum von 1968 bis 2008 das Thema Migration recherchiert und ist auf eine Verknüpfung vom dargestellten Bild der MigrantInnen mit der Ökonomie gestoßen. Im Artikel "Ich bin MuslimIn!" setzt sich Sonja Hinsch mit Bewältigungsstrategien muslimischer Jugendlicher gegen Vorurteile über die Herkunftsethnie oder die Religion auseinander. Diese stehen auch im Kontext einer inhaltlich veränderten religiösen und ethnischen Identität der Jugendlichen. Gamze Ongan zeigt auf, dass das in den Medien gerne aufgegriffene Thema "Zwangsheirat", im Unterschied zu ökonomischen Problemen, in den Beratungsstellen eine geringe Rolle spielt. Katharina Brizić befasst sich mit dem Erwerb der deutschen Sprache von Migrantenkindern und zeigt, dass der Sprachwechsel der (Groß)Eltern, z.B. von Kurdisch auf Türkisch, einen fundamentalen Einfluss hat. In einem Interview geht Bernhard Perchinig kritisch auf die sogenannte "Integrationsvereinbarung", den Wiener "Bildungspass", auf "europäische Grundwerte" und die fragwürdige Konstruktion von "uns" und "Anderen" ein. Hülya Hanci und Andrea Partsch stellen ein Projekt zur Förderung der Muttersprachen an einer Wiener kooperativen Mittelschule vor. Barbara Falkinger und Michael Rittberger führten ein Interview über das Nachhilfeinstitut "Phönix". Michael Sertl berichtet über Studierende mit Migrationshintergrund an der PH Wien. Kann man sie als Beispiele für "erfolgreiche Integration" sehen? Renée Winter führt eine Diskussion über die bildliche Darstellung von Migration, im Rahmen des Projektes "Viel Glück! Migration heute - Perspektiven aus Wien, Belgrad, Zagreb und Istanbul". Sevgi Bardakci hat Texte türkischer Jugendlicher gesammelt, die sich Gedanken zu verschiedenen Themen des Zusammenlebens in einer multikulturellen Gesellschaft machen. Diese sind auf Deutsch und Türkisch abgedruckt. Gerhard Petersdorfer hat sich dem Thema Migration und Macht graphisch genähert. Dazugehören oder nicht!? - bildet die Klammer der Texte der vorliegenden Nummer und kann auch als Kritik an gängigen Definitionen von Integration betrachtet werden, bei denen vordergründig ein einseitiger und nicht ein wechselseitiger Prozess in der Annäherung von Minderheiten und Mehrheiten beschrieben wird. Die Diskussion darüber muss geführt werden, um nicht in der Vorurteilsschleife hängen zu bleiben und um nicht die sozial Schwachen - die Menschen am Rand der Gesellschaft - gegenseitig auszuspielen. Dazugehören oder nicht!? - Wie lange muss man/frau sich als MigrantIn, Türke oder Türkin bezeichnen? Ab wann darf er/sie sich als ÖsterreicherIn fühlen und bezeichnen? Ist die Diskussion nicht oft kontraproduktiv und ausschließend, wenn mit den Begriffen "MigrantIn, TürkIn"Menschen bezeichnet werden, die sich nicht ausschließen sollten, aber sich niemals als dazugehörig fühlen dürfen? Die Antwort und eine neue Begriffl ichkeit bleibt auch die Redaktion schuldig, nicht aber den Anstoß zum Weiterdenken…. Barbara Falkinger Sevgi Bardakci Sevgi Bardakçı, Pädagogin in Wien 7, e-mail: sevgi_bardakci@yahoo.de Katharina Brizić, Sprachwissenschaftlerin, Musikerin und Musikpädagogin, leitet zur Zeit das Projekt "B.E.S.T." an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, e-mail: Katharina.brizic@chello.at Barbara Falkinger, Lehrerin in der Lerngemeinschaft Friedrichsplatz, Wien 15, Mediatorin im schulischen und interkulturellen Bereich, e-mail: barbara.falkinger@aon.at Hülya Hancı, Turkologin, Lektorin an der Orientalistik für Türkisch, unterrichtet an der NMS Selzergasse, Wien 15, im Projekt "Mehrsprachiger Unterricht in den Realienfächern - unter besonderer Berücksichtigung der Muttersprachen", e-mail: lionessss@gmx.at Barbara Herzog-Punzenberger, Institut für europäische Integrationsforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, e-mail: Barbara.Herzog-Punzenberger@oeaw.ac.at Sonja Hinsch, Soziologin, Wien, e-mail: sonja.hinsch@gmx.at Gamze Ongar, Leiterin der Migrantinnenberatungseinrichtung Peregrina und Chefredakteurin der Zeitschrift STIMME von und für Minderheiten, Wien Andrea Partsch, Lehrerin an der NMS Selzergasse, Wien 15, im Projekt"Mehrsprachiger Unterricht in den Realienfächern - unter besonderer Berücksichtigung der Muttersprachen", Sprachlehrerin in der Erwachsenenbildung, e-mail: andrea.partsch@schule.at Bernhard Perchinig, Politikwissenschafter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Wien, e-mail: bernhard.perchinig@oeaw.ac.at Gerhard Petersdorfer, Pädagoge und Künstler, Wien Michael Rittberger, Erziehungswissenschafter und Förderlehrer in Wien, email: michael.rittberger@tele2.at Michael Sertl, Soziologe an der Pädagogischen Hochschule des Bundes, Wien, Renée Winter, Historikerin, Wien, e-mail: renee.winter@refl ex.at Studienverlag: Schulheft 135Klappentext

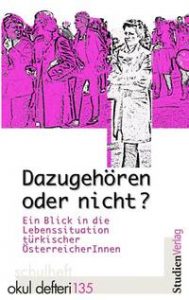 Dazugehören oder nicht!? - Wie lange muss man/frau sich als MigrantIn, Türke oder Türkin bezeichnen? Ab wann darf er/sie sich als ÖsterreicherIn fühlen und sich so nennen? Ist die Diskussion nicht oft kontraproduktiv und ausschließend, wenn mit den Begriffen "MigrantIn, TürkIn" Menschen bezeichnet werden, die sich nicht ausschließen sollten, aber niemals als dazugehörig fühlen dürfen?
Dazugehören oder nicht!? - Wie lange muss man/frau sich als MigrantIn, Türke oder Türkin bezeichnen? Ab wann darf er/sie sich als ÖsterreicherIn fühlen und sich so nennen? Ist die Diskussion nicht oft kontraproduktiv und ausschließend, wenn mit den Begriffen "MigrantIn, TürkIn" Menschen bezeichnet werden, die sich nicht ausschließen sollten, aber niemals als dazugehörig fühlen dürfen?
Dieses schulheft versucht ein okul defteri zu sein, also die Perspektive türkischer ÖsterreicherInnen ins Zentrum zu rücken.
Dazugehören oder nicht!? - Wie lange muss man/frau sich als MigrantIn, Türke oder Türkin bezeichnen? Ab wann darf er/sie sich als ÖsterreicherIn fühlen und sich so nennen? Ist die Diskussion nicht oft kontraproduktiv und ausschließend, wenn mit den Begriffen "MigrantIn, TürkIn" Menschen bezeichnet werden, die sich nicht ausschließen sollten, aber niemals als dazugehörig fühlen dürfen?
Dieses schulheft versucht ein okul defteri zu sein, also die Perspektive türkischer ÖsterreicherInnen ins Zentrum zu rücken.Inhalt
Dazugehören oder nicht?
Österreich und seine 2. und 3. (MigrantInnen-) Generation
Zur Situation türkischer MigrantInnen in Österreich
Demographische Struktur, Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen
Wie kommt die Ausländerfeindlichkeit in die Kronen Zeitung?
"Ich bin Muslimin!"
Religiöse und ethnische Identitäten als Bewältigungsstrategien muslimischer
Jugendlicher der Zweiten Generation
Zuschreiben oder ernsthaftes Bekämpfen
Zwangsverheiratung aus der Perspektive der Bildungs-, Beratungs- und
Therapieeinrichtung Peregrina
Bilderzyklus - "Willkommen Österreich"
Spracherwerb in der 2. MigrantInnengeneration
Eine Wiener soziolinguistische Studie
"Es geht nicht um eine Änderung der Identität!"
Interview mit Bernhard Perchinig über Stärken und Schwächen der
Integrationspolitik in Österreich
Mehrsprachiger Unterricht in den Realfächern - Sprachförderung
unter besonderer Berücksichtigung der Muttersprachen
Phönix: Ein Nachhilfeinstitut mit mehreren Gesichtern
Ungehobene Schätze
Studierende mit Migrationshintergrund an der PH Wien
Migration ausstellen
Toleranz - Hösgörü
Bildung - Kompozisyan
Almanlarin (Avusturyalilarin) Önyargilar
Schwierigkeiten , denen wir ausgesetzt sind - Yasadigimiz zortuklarVorwort
Michael RittbergerAutorInnen
Redaktion
Barbara Falkinger
Sonja Hinsch
Michael Rittberger
Michael SertlAutorInnen
e-mail: michael.sertl@aon.atBestellen