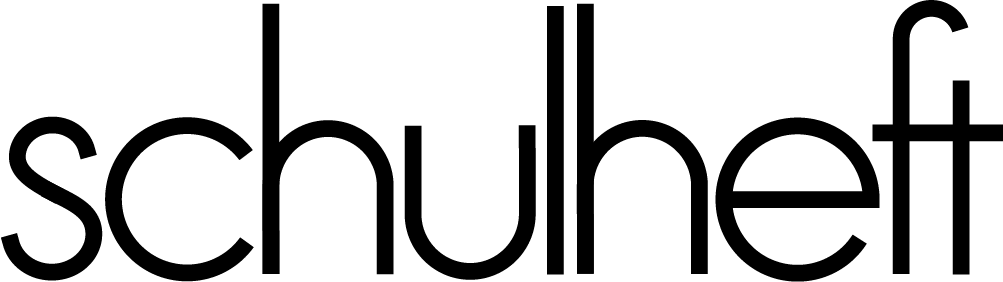leben = lesen? Alphabetisierung und Basisbildung
in der mehrsprachigen Gesellschaft
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen sich neue Herausforderungen, denen sich die Erwachsenenbildung stellen muss: Die Ergebnisse der PISA-Studien lassen vermuten, dass Basisbildungs-angebote für Erwachsene zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Lesen- und Schreiben-Können allein reicht in der digitalisierten Gesellschaft nicht mehr aus, um die Anforderungen des Alltags erfüllen zu können. Dabei rückt auch die Mehrsprachigkeit vieler MitbürgerInnen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Förderer und bildungspolitische EntscheidungsträgerInnen sind gefordert, entsprechende Bildungsangebote zu schaffen und allgemein zugänglich zu machen, um den BürgerInnen zu ermöglichen, eigenständig und entscheidungsfähig zu bleiben. Im vorliegenden schulheft werden Rahmenbedingungen und Situation der Erwachsenenalphabetisierung und Basisbildung im heutigen Österreich beschrieben und Beispiele aus der Praxis aufgezeigt. 1. Hintergründe und gesellschaftliche Zusammenhänge Antje Doberer-Bey, Angelika Hrubesch Antje Doberer-Bey Werner Mayer Angelika Hrubesch Gerhild Ganglbauer Christian Kloyber 2. Programme und Maßnahmen Martin Netzer Sonja Muckenhuber Birgit Aschemann Markus Bönisch, Eduard Stöger 3. Beispiele aus der Praxis Elisabeth Simm Edda Hahn-Zimmermann Julia Rührlinger Dietrich Eckardt Die vorliegende Ausgabe des schulheftes schließt an das schulheft131/2008 schriftlos = sprachlos? Alphabetisierung und Basisbildung in der marktorientierten Gesellschaft an mit dem Ziel, den interessierten LeserInnen einen aktualisierten Überblick über die Diskussionen und Entwicklungen rund um die Alphabetisierung und Basisbildung mit Erwachsenen zu liefern. Das Thema hat nichts an Aktualität eingebüßt; es steht zunehmend im Fokus des öffentlichen Interesses und ist in den letzten Jahren konkret zum Ziel von bildungspolitischen Maßnahmen geworden, zwecks mittelfristiger Lösung der Problemlagen. Ein Aspekt, der heute verstärkt diskutiert wird, ist die Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft, die als Normalität in der Migrationsgesellschaft betrachtet werden sollte und im erwachsenenbildnerischen Kontext außerhalb von Sprachangeboten noch viel zu wenig Berücksichtigung im Sinn von Wertschätzung und Anerkennung findet. Dieser Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch die meisten Beiträge oder ist zumindest als Randthema präsent. In den ersten Beiträgen des Heftes soll der gesellschaftliche Zusammenhang beleuchtet werden, in dem sich die Basisbildung in Österreich bewegt, dann soll kurz die Programmlandschaft aktuell dargestellt werden, die geprägt ist von Entwicklungen und Aktivitäten wachsender Netzwerke und die sich besonders durch die Initiative Erwachsenenbildung seit 2008 grundlegend verändert hat. Zuletzt sollen die PraktikerInnen zu Wort kommen: mit vier Beispielen aus gelungenen bzw. gelingenden Überlegungen und Aktivitäten in der Basisbildung. Antje Doberer-Bey und Angelika Hrubesch werfen die Frage auf, was heute unter Basisbildung zu verstehen ist. Es werden die verschiedenen Begrifflichkeiten in ihren historischen Kontexten erläutert, die ihre Bedeutung bestimmen, und die ihnen jeweils zugrundeliegenden Konzepte und Implikationen dargelegt. Antje Doberer-Bey fasst die Ergebnisse einer qualitativen empirischen Untersuchung zusammen, die sich mit den Ursachen für Fehlentwicklungen beim schulischen Erwerb von Schriftsprachlichkeit und den Erfolgen im Erwachsenenalter durch den Besuch eines Basisbildungskurses befasst. Dabei wird die Bedeutung des gesellschaftlichen Strukturwandels durch technologische Entwicklungen ebenso in den Blick genommen wie der Stellenwert von Schriftsprache und dies insbesondere vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeitsstrukturen und Beschäftigungsverhältnisse. Wie sich diese auf die Leben der Einzelnen auswirken, in welchem Verhältnis sie zu biografischen Aspekten der Befragten stehen und welche Schlussfolgerungen für die Praxis der Basisbildung gezogen werden, wird in diesem Beitrag thematisiert. Werner Mayer schließt mit der Frage an, wie Kinder trotz Schulbesuchs lesen lernen und führt den LeserInnen in seinem Beitrag Schwierigkeiten und Herausforderungen im heutigen Schul- bzw. Bildungssystem wie auch Beispiele gelingender Alphabetisierung vor Augen. Er stellt darin mehrsprachige Kinder vor und beschäftigt sich mit dem Lesen- und Schreiben-Lernen in der Zweitsprache Deutsch, wonach Angelika Hrubesch Überlegungen zur Basisbildung mit Erwachsenen in der Migrationsgesellschaft anschließt. Sie wirft in ihrem Beitrag die Frage auf, was bei der Planung und Gestaltung von Alphabetisierungsbzw. Basisbildungsangeboten in unserer mehrsprachigen Gesellschaft beachtet werden muss und wie bedürfnisorientierte Arbeit im aktuellen Kontext erfolgen kann. Mit dem Beitrag von Gerhild Ganglbauer – selbst Unterrichtende im Bereich Alphabetisierung/Basisbildung und Deutsch als Zweitsprache – sollen jene in den Vordergrund gestellt werden, die die „eigentliche Arbeit“ leisten und Unterricht- bzw. Lernangebote tagtäglich gestalten und begleiten. Im Beitrag wird die prekäre Arbeitssituation der TrainerInnen den umfassenden Herausforderungen gegenüber gestellt, und es werden gar nicht so unerfüllbar scheinende Wünsche formuliert, die die Arbeitszufriedenheit erheblich verbessern könnten. Christian Kloyber setzt sich kritisch mit dem Verhältnis von Alphabetisierung/Basisbildung und Erwachsenenbildung auf internationaler und nationaler österreichischer Ebene auseinander. Das verdeckte und widersprüchliche Verständnis von Bildung hinter der Kompetenzorientierung, das einem personalen Bildungsverständnis zuwiderläuft, wird ebenso thematisiert wie häufige vorgefasste Meinungen und unzulässige Zuschreibungen beispielsweise im Kontext von Mehrsprachigkeit, wenn Deutschlernen mit Basisbildungsbedarf oder Sonderförderbedarf gleichgesetzt wird. Schließlich werden Prinzipien für die Arbeit in der Alphabetisierung und Basisbildung dargelegt, die dem jüngst erarbeiteten Curriculum für die Ausbildung von BasisbildungspädagogInnen zugrundgelegt sind und einem umfassenden, emanzipatorischen und integrativen Konzept Rechnung tragen. Martin Netzer stellt in seinem Beitrag die Initiative Erwachsenenbildung vor, die das kostenlose Nachholen von grundlegenden Bildungsabschlüssen vorsieht. Sie beruht auf der strategischen Partnerschaft zwischen Ländern und Bund, die die Kosten zu gleichen Teilen tragen. Ihr Ziel ist die Sicherstellung der Grundkompetenzen im Erwachsenenalter und die qualitative Weiterentwicklung der Bildungsprogramme. Auf der Website der schulhefte (www.schulheft.at) finden sich zur Ergänzung weitere wichtige Beiträge, die für diesen Band zusammengestellt wurden und der Darstellung der Situation der Basisbildung in der österreichischen Erwachsenenbildung dienen: Von Sonja Muckenhuber und Birgit Aschemann werden zwei große Netzwerke beschrieben, die sich in Österreich mit Alphabetisierung bzw. Basisbildung beschäftigen: In.Bewegung und MIKA. Im Rahmen dieser Verbünde werden mit Unterstützung von Europäischem Sozialfonds ESF und dem Unterrichtsministerium wichtige Entwicklungen vorangetrieben, wie spezifische Kursmodelle, Qualitätssicherung, die Ausbildung von TrainerInnen oder Beiträge zur Forschung, um nur einige zu nennen. Markus Böhnisch und Eduard Stöger präsentieren in ihrem Beitrag auf der Website die internationale Studie PIAAC der OECD, die erstmals für Österreich Daten im Bereich der Schlüsselkompetenzen Erwachsener erhebt, die für die Teilhabe an der Gesellschaft und in der Wirtschaft erforderlich sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den grundlegenden Lese- und Rechenfähigkeiten und den Fertigkeiten zur Nutzung des Computers und des Internets für Informationen und zur Lösung von Problemen im beruflichen und privaten Alltag. Aus der Praxis berichten die nächsten Beiträge. Elisabeth Simm widmet sich der Schnittstelle zwischen Ämtern, Beratungsstellen und Erwachsenen, die gerade im Zusammenhang mit behördlichen Dokumenten nicht in der Lage sind, diese zu verstehen und sich erfolgreich schriftlich, oft auch mündlich, zu artikulieren. Sie berichtet von sehr unterschiedlichen Reaktionen auf Seiten der Behörden und entwirft Szenarien für die Entschärfung von kritischen Situationen, die oft zu weitreichenden Folgen führen. Edda Hahn-Zimmermann stellt in ihrem Beitrag theoretisches Wissen über Lernberatung den konkreten Herausforderungen gegenüber, denen sie als Beraterin im Kontext Alphabetisierung und Deutsch als Zweitsprache begegnet. Sie zeigt auf, dass viele Dinge schwer umsetzbar sind, wenn Ressourcen knapp sind und keine gemeinsame (Meta)Sprache die Kommunikation zwischen LernerIn und BeraterIn erleichtern kann, zumal die Personen, die die Beratung in Anspruch nehmen, oft auch viel eher und dringender mit sozialen und gesetzlichen Schwierigkeiten beschäftigt sind als mit ihrem persönlichen Lernprozess. Julia Rührlinger beschreibt in ihrem Beitrag, wie ermächtigende Basisbildung den Teilnehmenden die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und ihnen neben dem Erwerb von Schriftsprachkenntnissen und grundlegenden Kompetenzen auch zu einer stärker selbstbestimmten Lebensführung und (Selbst-)Ermächtigung verhilft. Es werden die erforderlichen Rahmenbedingungen für das Gelingen der Empowerment-Prozesse ausführlich beschrieben und die besondere Rolle der TrainerInnen hervorgehoben. Dietrich Eckardt schildert die Praxis der Alphabetisierung mit weiblichen Roma in der Berliner Justizvollzugsanstalt für Frauen und die besonderen Bedingungen, unter denen diese Arbeit stattfindet. Mit Rückblick auf die Geschichte, ihre Traditionen, aber auch den Diskriminierungen, denen diese Volksgruppe seit jeher ausgesetzt ist, werden ihre heutigen Lebensbedingungen dargestellt und es wird auf die anstehenden bildungspolitischen Aufgaben und Herausforderungen verwiesen. Redaktion Antje Doberer-Bey AutorInnen Birgit Aschemann, Mag.a Dr.in, Psychologin und Bildungswissenschafterin, tätig im Frauenservice Graz (Fachbereich Forschung und Entwicklung) und an der Universität Graz (Lehrbeauftragte/Pädagogik), seit 2008 im Netzwerk MIKA vertiefte Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Begleitung, Professionalisierung und Qualitätssicherung der Alphabetisierungs- und Basisbildungsarbeit mit MigrantInnen. Markus Bönisch, Mag., seit 2005 wissenschaftlicher Projektleiter beiStatistik Austria und nationaler Projektmanager für PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Kompetenzforschung, Bildung und Arbeitsmarkt, Survey methodology. Antje Doberer-Bey, Dr.in, Lehrgangsleiterin und Basisbildungsexpertin in verschiedenen Gremien des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, Schwerpunkte Professionalisierung von TrainerInnen und Qualitätssicherung. Dietrich Eckardt, seit über zehn Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, hat überwiegend mit Menschen am Rande der Gesellschaft gearbeitet. Derzeit freier Mitarbeiter für Grundbildung und Alphabetisierung in der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin sowie Sprachförderkraft in einer Brennpunkt-Kita. Gerhild Ganglbauer, Mag.a, Studium der Philosophie und Anderes, Uni Wien, seit 2004 als Kursleiterin in der Basisbildung mit MigrantInnen tätig. Edda Hahn-Zimmermann M.A., Trainerin im Bereich Basisbildung und Deutsch als Zweitsprache, Referentin im Lehrgang Alphabetisierung/Basisbildung und Deutsch mit MigrantInnen, Lernberaterin (im Versuch), an vielerlei Sprachen sehr interessiert. Angelika Hrubesch, Mag.a, seit 1999 im Bereich DaZ und Alphabetisierung/Basisbildung seit 2011 Leiterin des AlfaZentrums für MigrantInnen im lernraum.wien der Wiener Volkshochschulen und des Lehrgangs Alphabetisierung/Basisbildung und Deutsch mit MigrantInnen. Christian Kloyber, Dr., Leiter des Geschäftsfeldes Bildungsentwicklung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang. Werner Mayer, ehemals Leiter und Lehrer einer Grundschule in Wien, war am Aufbau des Sprachförderzentrums Wien beteiligt. Sonja Muckenhuber, Mag.a, Soziologin; Leiterin des Grundbildungszentrums der Volkshochschule Linz; Koordinatorin des Projekts In-Bewegung-Lernergebnisorientierung, des Alfatelefons Österreichs und des Internetportals www.basisbildung-alphabetisierung.at; Leitung der StarterInnenpakete und der Kompaktausbildung für BasisbildungstrainerInnen. Martin Netzer, Mag., Bereichsleiter für Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und Vorsitzender der Nationalen Plattform für lebensbegleitendes Lernen. Julia Rührlinger, Mag.a, zertifizierte Erwachsenenbildnerin, hat 2011 das Studium der Internationalen Entwicklung an der Universität Wien absolviert und ihre Diplomarbeit zum Thema Empowerment in der Basisbildung verfasst. In den letzten Jahren als Kursleiterin an der VHS Floridsdorf in unterschiedlichen Basisbildungskursen tätig. Elisabeth Simm, Dr.in, seit 1999 Beraterin und Prozessbegleiterin bei der Opferschutzeinrichtung „Gewaltschutzzentrum Salzburg“. Als Deutsch-Philologin sowie Lebens- und Sozialberaterin galt ihr besonderes Interesse zuletzt den möglichen Zusammenhängen von Literarität und Chancen der nachhaltigen Befreiung aus Gewaltbeziehungen. Seit 2012 arbeitet sie nebenberuflich als Trainerin für Basisbildung am Salzburger Berufsförderungsinstitut. Eduard Stöger, Dr., seit 2008 als wissenschaftlicher Projektleiter bei der Statistik Austria. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen u.a. Erwachsenenbildung, Kompetenzforschung sowie die Berufs- und Betriebspädagogik. Studienverlag: Schulheft 149Klappentext
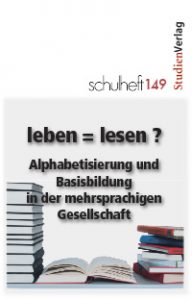
Was ist eigentlich „Basisbildung“?
Alphabetisierung mit Erwachsenen
Von Fehlentwicklungen beim schulischen Erwerb von Schriftsprachlichkeit und Lernerfolgen im Erwachsenenalter
Wie lernen Kinder trotzdem lesen?
Alphabetisierung und Basisbildung in der Migrationsgesellschaft
Wünsch dir was!
Zur Situation der TrainerInnen in der Basisbildung
Perspektiven integrierter Ausbildungen
Anmerkungen zur kritischen Professionalisierung in der Alphabetisierung und Basisbildung
Kostenlose Bildungsangebote für Erwachsene
Initiative Erwachsenenbildung – ein gemeinsames Förderprogramm des Bundes und der Länder
Basisbildung In.Bewegung
Entwicklungen der Basisbildung in Österreich anhand der Geschichte des Netzwerks In.Bewegung (Download PDF)
MIKA – was ist das? (Download PDF)
PIAAC: Eine innovative und internationale Studie über Schlüsselkompetenzen Erwachsener (Download PDF)
„Wenn Sie das bitte eben ausfüllen ....“
Wie nehmen Ämter und Beratungsinstitutionen Basisbildungsbedarf wahr? Was kann verbessert werden?
Me no speak gut Deutsch
Erfahrungen aus der Lernberatung und Lernbegleitung im Bereich Basisbildung und Deutsch als Zweitsprache
Von Menschen, die ihre Leselust entdecken
Eine Aktionsforschung zu Empowerment in der lernerInnenzentrierten Basisbildung
„Mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich hätte lesen und schreiben können.“
Alphabetisierung von erwachsenen weiblichen Roma am Beispiel der Justizvollzugsanstalt für Frauen BerlinVorwort
AutorInnen
Angelika HrubeschBestellen
Ergänzende Beiträge
Sonja Muckenhuber: Basisbildung in Bewegung [pdf]
Birgit Aschemann: MIKA – was ist das? [pdf]