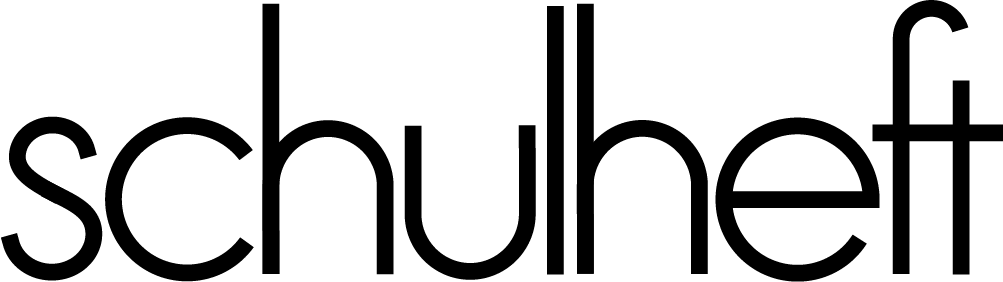Bildungsdünkel – Bildung als Distinktion und soziale Beschämung
Dieses schulheft beschäftigt sich mit dem eminent sozialen Charakter von Bildung und nimmt die verschwiegene Seite von Bildungsprozessen und die sozialen Folgen eines allgegenwärtigen Bildungsdünkels in den Blick. Neben Formen sozialer Beschämung werden aber auch Bewältigungsstrategien von Betroffenen und Bildungsprozesse jenseits der als legitim geltenden Bildungsinstitutionen thematisiert. Uwe Bolius (1940–2014) Editorial Alex Demirović Michael Rittberger Michael Sertl Manfred Krenn Marianne Neissl Uwe H. Bittlingmayer/Ullrich Bauer Ingolf Erler Daniela Holzer Stefan Vater AutorInnen Bildung, und zwar legitime, d.h. institutionalisierte Bildung wird im neoliberalen Regime zunehmend zur entscheidenden Voraussetzung für soziale Teilhabe erklärt und damit zu einem Mittel sozialer Marginalisierung. Dieses schulheft beschäftigt sich daher mit dem eminent sozialen Charakter des Bildungsbegriffs und nimmt die verschwiegene, gewaltträchtige Seite von Bildungsprozessen in den Blick. Bildungsdünkel scheint dabei auf den ersten Blick eine seltsame Wahl zu sein. In Zeiten der Bildungsexpansion nimmt er sich wie ein etwas verstaubter Begriff aus, der sich in einem historischen Sinne auf die elitäre Haltung des deutschsprachigen Bildungsbürgertums bezieht. Wir finden allerdings, dass er hochaktuell ist und sich eben nicht nur auf das klassische Bildungsbürgertum beschränken lässt. Wir gehen sogar von einer Verallgemeinerung von Bildungsdünkel als einem zentralen Deutungsmuster gegenwärtiger europäischer Gesellschaften aus, der sich allerdings in höchst subtilen, in die Strukturen der Gesellschaft eingebetteten und insofern versteckten Formen Bahn bricht. Wer nicht dem gängigen Bildungskanon mit seinen schulischen Abschlüssen entspricht, gilt daher als dumm oder unbegabt. Wer sich nicht lebenslang (legitimen) Bildungsprozessen unterwerfen will, wird moralisch als „bildungsfern“ abgewertet. Lernprozesse jenseits schulischer Zertifizierung, wie handwerklich-praktisches, soziales und Erfahrungslernen wird dabei unterschätzt, Bildungstitel werden symbolisch überhöht. Geradeweil die sozialen Folgen eines allgegenwärtigen Bildungsdünkels anders als in früheren Zeiten die sozialen Chancen von vielen Menschen empfindlich beeinträchtigen können, ist es hoch an der Zeit, sich differenziert mit legitimer Bildung, ihrem sozialwillkürlichen Charakter sowie ihrem sozialen Beschämungspotenzial auseinanderzusetzen. Um dies leisten zu können, muss zunächst der vorherrschende Bildungsbegriff selbst dekonstruiert, und das bedeutet, seines quasi-natürlichen Charakters entkleidet und als soziale Konstruktion sichtbar gemacht werden. Dabei spielen historische Analysen eine wichtige Rolle, um die Konstruktionsprozesse im Laufe der Geschichte begreifbar zu machen. In einem zweiten Schritt ist es von Bedeutung, die Formen symbolischer Gewalt legitimer Bildung und Schriftsprache möglichst detailliert und auch empirisch in den Blick zu nehmen. Das reicht von Beschämungserfahrungen in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Alltagsleben bis hin zu Schwierigkeiten in der Anerkennung informell erworbener Kompetenzen. Dazu ist es notwendig, den Blick auf Bildungsungleichheiten und auf die beschämungsträchtigsten Gruppen der Gesellschaft zu richten. Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen sind am extremsten von einem verallgemeinerten Bildungsdünkel betroffen, weshalb wir uns ausführlich mit diesem sozialen Phänomen beschäftigen. Aber auch alternative Bildungsprozesse und Kompetenzen als das Abgewertete, das Andere, dem häufig die Legitimität, überhaupt als Bildung Geltung beanspruchen zu können, abgesprochen wird, gehören zu einer umfassenden Beschäftigung mit dem Phänomen des Bildungsdünkels. Ebenso Platz hat darin der Aspekt des Widerstandes gegen die mit legitimer Bildung verbundenen Zumutungen. Bildungswiderstand bezieht sich dabei in vielfältiger Weise auf einen verallgemeinerten Bildungsdünkel und die institutionellen Formen, in denen dieser reproduziert wird. Der vorliegende Band beschäftigt sich also mit Formen des Bildungsdünkels und des alltäglichen Widerstands dagegen. Anden Anfang gestellt ist dabei die Auseinandersetzung mit dem deutschsprachigen Bildungsbegriff und die Frage nach dem Bildungsbürgertum. Im ersten Beitrag liefert Alex Demirovič eine Kritik des Bildungsbegriffs und stellt die Frage nach den Möglichkeiten einer Produktion kritischen Wissens. Im Beitrag von Michael Rittberger wird ein Überblick über Bildungskonzepte der Pädagogik im Laufe der Zeit gegeben, was eine historische Annäherung an das Problem ermöglicht. Michael Sertl wiederummacht sich am Beispiel der Reformpädagogik auf die Suche nach einer Soziologie des Bildungsbürgertums. Im zweiten Teil des Bandes beschäftigt sich Manfred Krenn mit dem sozialen Beschämungspotenzial, das Schriftsprache als dominanter Literalität innewohnt, und damit, welchen Formensymbolischer Gewalt und Bildungsbenachteiligung Personenmit geringen Schriftsprachkompetenzen ausgesetzt sind. Anschließend beschreibt Marianne Neissl das Ausblenden und Ignorieren von Scheitern und Beschämung im pädagogischen Handeln. Formen alternativen Lernens stehen im Vordergrund des dritten Abschnitts. Auch Ullrich Bauer und Uwe H. Bittlingmayer zeigen am Beispiel des sog. „funktionalen Analphabetismus“ und der Strategien seiner Vermeidung, dass Bildungsdünkel und (extreme) Schulbildungsferne nur zwei Seiten einer einzigen Medaille sind. Ingolf Erler fordert in seinem Beitrag eine größere Beachtung von Formen handwerklich-manuellen Lernens und der Anerkennung von Erfahrungswissen im Bildungsdiskurs ein. Zwischen den einzelnen Teilen finden sich Auszüge aus Interviews, die Manfred Krenn im Zuge seiner Studie mit Personen geführt hat, die im Laufe ihrer Schullaufbahn Diskriminierungen ausgesetzt waren. Dabei werden nicht nur Effekte sozialer Beschämung durch Schriftsprache anhand einzelner Biographien nachvollziehbar, sondern auch erfolgreiche Bewältigungsformenextremer Bildungsbenachteiligung. Im abschließenden Teil behandelt Daniela Holzer Formen des Bildungswiderstands als Reaktion auf Bildungszumutungen. Stefan Vater behandelt Bildungswiderstände in der Schule am Beispiel der klassischen Studie von Paul Willis „Learning to labour“. Der vorherrschende (Bildungs)Diskurs rückt die individuellen Bildungsanstrengungen und Defizite in den Mittelpunkt und verlagert damit die Verantwortung für soziale Marginalisierung in die Individuen hinein. Mit der Thematisierung der von uns sogenannten „Verallgemeinerung von Bildungsdünkel“ stellen wir im Gegensatz dazu mit diesem Heft Überlegungen und Erkenntnisse zur Diskussion, die den Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse richten. Diese bringen nicht nur die Bildungsungleichheiten hervor, sondern auch die symbolischen Deutungen, die diese mit Legitimität ausstatten und die Bildungsverlierer beschämen und stigmatisieren. Ullrich Bauer, Dr., Professor für Sozialisationsforschung an der Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Zentrum für Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter (ZPI), ullrich.bauer@uni-bielefeld.de Uwe H. Bittlingmayer, Dr., Professor für Allgemeine Soziologie mit Schwerpunkt Bildungsforschung am Institut für Soziologie, Pädagogische Hochschule Freiburg, uwe.bittlingmayer@ph-freiburg.de Alex Demirovič , apl. Prof. Dr., Sozialwissenschaftler, Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin Ingolf Erler, Mag., Bildungssoziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung Daniela Holzer, Dr.in, Assistenzprofessorin im Fachbereich Weiterbildung des Instituts für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universität Graz Manfred Krenn, Dr., Arbeitssoziologe, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA), Wien Marianne Neissl, Mag.a, Mitarbeiterin am Institut für Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz Michael Rittberger, Mag., Dr., Studium der Erziehungswissenschaft, Integrationslehrer an einer NMS, rittberger@tmo.at Michael Sertl, Dr. phil., Soziologe, ehemaliger Hauptschullehrer, PH Wien (seit Nov. 2014 im Ruhestand). Forschungsschwerpunkte: Schule und soziale Ungleichheit; Soziologie der Schule und des Unterrichts. Stefan Vater, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verbands Österreichischer Volkshochschulen. Lehrbeauftragter für Genderstudies und Bildungssoziologie an den Universitäten Wien und Fribourg (CH)Klappentext

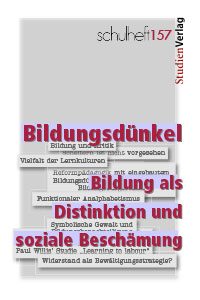 Im Gegensatz zur vorherrschenden, uneingeschränkt positiven Konnotation von Bildungsprozessen enthalten diese oftmals Formen symbolischer Gewalt. So werden niedrige schulische Abschlüsse vorwiegend als Mangel an Intelligenz gedeutet. Das Spektrum reicht dabei von Beschämungserfahrungen in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Alltagsleben bis hin zu Schwierigkeiten in der Anerkennung informell erworbener Kompetenzen.
Im Gegensatz zur vorherrschenden, uneingeschränkt positiven Konnotation von Bildungsprozessen enthalten diese oftmals Formen symbolischer Gewalt. So werden niedrige schulische Abschlüsse vorwiegend als Mangel an Intelligenz gedeutet. Das Spektrum reicht dabei von Beschämungserfahrungen in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Alltagsleben bis hin zu Schwierigkeiten in der Anerkennung informell erworbener Kompetenzen.Inhalt
Bildung und Gesellschaftskritik
Zur Produktion kritischen Wissens
Die Geschichte des Bildungsbegriffs
Reformpädagogik mit eingebautem Bildungsdünkel
Zur Soziologie des Bildungsbürgertums
Symbolische Gewalt und Bildungsbenachteiligung
Zum sozialen Beschämungspotenzial von Schriftsprache
Scheitern ist nicht vorgesehen
Funktionaler Analphabetismus als notwendige Kehrseite von Bildungsdünkel
Vielfalt der Lernkulturen
Widerstand als Bewältigungsstrategie?
Wirklich nützliches Wissen?
Überlegungen, ausgehend von Paul Willis’ Studie „Learning to labour“Vorwort
AutorInnen
Bestellen