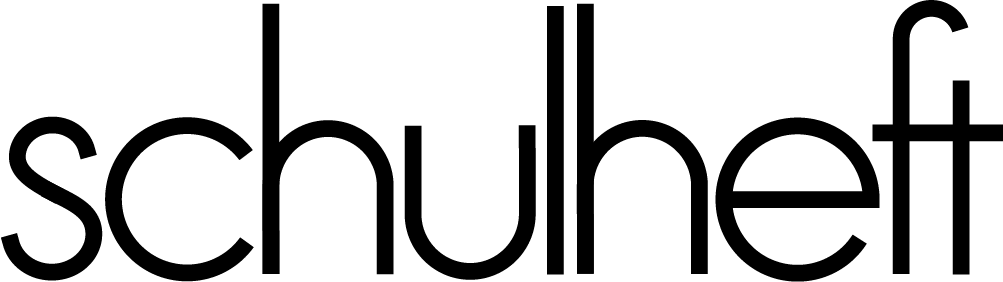Schulsprachen –
Sprachen in und um und durch die Schule
Dieses schulheft will verschiedene methodische Zugänge zu Sprachen in der Schule aufzeigen, von Schulsprachprofilen über Anerkennungspreise zu Grassroots-Initiativen, und Forschende und Lehrende zu Wort kommen lassen, die vielfältige Erfahrungen mit sprachlichen Praktiken und heteroglossischen Lebenswelten gesammelt haben. Die Redakteurinnen, Judith Purkarthofer und Brigitta Busch, arbeiten als Sprachwissenschafterinnen an der Universität Wien und beschäftigen sich mit heteroglossischen Lebenswelten. Judith Purkarthofer, Brigitta Busch Christian Schreger Marija Zvonarits-Karall Cora Zölss Martina Rienzner (unter Mitarbeit von Rawda Mahamud) Judith Purkarthofer Brigitta Busch Isabella Hörbe Julia Wohlgenannt Stefan Pernes Claudia Kral Judith Purkarthofer Brigitta Busch, Judith Purkarthofer AutorInnen Judith Purkarthofer, Brigitta Busch Einleitung und Zielsetzung Schulischer Alltag ist mehrsprachig. Manchmal wird diese Mehrsprachigkeit als großer Gewinn und sehr erstrebenswertes Ziel gesehen, manchmal aber auch als Belastung und Hindernis. Je nach Situation bemühen sich Lehrende und SchülerInnen, manche Sprachen intensiv zu fördern und einzufordern, während sie andere vermeiden oder schlicht vergessen, auch wenn diese im außerschulischen Leben eine große Rolle spielen. Dieses schulheft will verschiedene methodische Zugänge zu Sprachen in der Schule aufzeigen, von Schulsprachprofilen über Anerkennungspreise zu Grassroots-Initiativen, und Forschende und Lehrende zu Wort kommen lassen, die vielfältige Erfahrungen mit sprachlichen Praktiken und heteroglossischen Lebenswelten gesammelt haben. Lehrende geben uns Einblick in ihre mehrsprachigen Klassen und schulpraktischen Projekte, Forschende aus dem Umfeld der Forschungsgruppe Spracherleben stellen sowohl wissenschaftliche Zugänge vor – wie etwa biographisch geleitete Workshops mit SchülerInnen, Linguistic Landscapes und multimodale Textproduktionen – als auch schulpraktische Projekte und schulentwicklerische Begleitung. Die Kombination dieser verschiedenen Perspektiven und AkteurInnen gibt eine Idee von der Komplexität der Situation, aber auch von den vielen Möglichkeiten, mehrsprachige Schulen als Lernumgebungen zu unterstützen. Manche Autorinnen und Autoren sind schon viele Jahre in der Schule tätig, andere haben gerade erst begonnen, sich (wieder) dem komplexen System schulischer und sprachlicher Regelungen zu nähern. Dementsprechend sind die Formen der Beiträge den Wünschen und Stimmen angepasst und lassen viele verschiedene Perspektiven auf Schule sichtbar werden. Aus den Texten spricht Freude am Ausprobieren und bisweilen Frustration über das (gefühlte) Scheitern an den vielzitierten Umständen – gemeinsam ist den Beiträgen in diesem schulheft aber, dass Sprachen und Sprachformen in schulischen Kontexten als sehr relevant und die Auseinandersetzung damit als gesellschaftlicher Auftrag und persönliches Anliegen erlebt werden. Für die Mitarbeit – an den vielen Schulprojekten, Forschungsvorhaben und Schulbesuchen – möchten wir uns bei all den Schulen, ihren SchülerInnen, Lehrenden und Leitungen bedanken, die uns über die Jahre aufgenommen und uns Einblicke in ihren Alltag und Diskussionen über die Welt gewährt haben. Wir hoffen, sie finden sich im Anliegen dieses schulhefts wieder! Die Situation in österreichischen Schulen wird diskutiert – im Hinblick auf Testergebnisse, auf die Zufriedenheit von Kindern, Eltern, Lehrenden und „der Gesellschaft“, auf die Kosten für Lehrende und Gebäude und die allgemeinen Strukturen vom Dienstrecht bis zur „Gesunden Jause“. Für ein Ernstnehmen der Sprachen, die Schülerinnen und Schüler mitbringen, und gegen die Obsession des Messens von kaum Meßbarem spricht sich Christian Schreger, Lehrender in einer Wiener Volksschule, in seinem engagierten Beitrag aus. Traditionell gibt es ganz verschiedene Formen mehrsprachiger Schulgestaltung: Neben dem klassischen Fremdsprachenunterricht (von Latein und Altgriechisch zu Spanisch und Chinesisch) spielen dafür auch die Schulen im Minderheitenschulwesen eine Rolle, die den zweisprachigen Unterricht im Hinblick auf die mehrsprachigen Umgebungen zu erweitern trachten. Cora Zölss und Marija Zvonarits-Karall, beide Lehrende an zweisprachigen Kleinschulen im Burgenland, geben Einblick in die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Schulform. Eine weitere Form des Sprachunterrichts stellt der muttersprachliche Unterricht dar, der seit den 1970ern in Österreich möglich ist. Der Weg zur Aufnahme einer Sprache in das Angebot und die Auswirkungen dieser Anerkennung auf SchülerInnen, Lehrende und Eltern zeichnet Martina Rienzner (unter Mitarbeit von Rawda Mahamud) am Beispiel von Somali nach. Aktionsforschung von Lehrenden in ihren eigenen Schulen und Forschende, die mit unterschiedlichen Interessen und Aufträgen in Schulen kommen, sind auf der Suche nach Erkenntnissen – oft nach sehr spezifischen, aber auch oft nach einem grundlegenden Verständnis von Lernprozessen. In diesem Sinne ist der Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft (so man diese als einander entgegengesetzte Pole konstruieren möchte) hochrelevant. Brigitta Busch gibt einen Einblick in die Forschung zu Spracherleben anhand einer multimodal verwirklichten Erzählung, die sich mit Teilhabe und der Verhandlung von Zugehörigkeiten beschäftigt. Judith Purkarthofer beschreibt Chancen von kooperativer Forschung für die Schulentwicklung wie auch die Soziolinguistik. Sprachenlernen und Auseinandersetzung mit Sprachen erschöpft sich nicht in der Vermittlung von Sprache als System, sondern thematisiert gleichzeitig Sprache als Distinktionsmerkmal und soziales Kapital. Dabei sind nicht nur sogenannte Einzelsprachen (wie eben Deutsch, Türkisch oder Xhosa) relevant, denn auch Sprachformen (wie Dialekte oder Jugendsprachen) werden von SprecherInnen wahrgenommen, bewertet und (im schulischen Kontext) fallweise sanktioniert. Isabella Hörbe beschäftigt sich mit Sprechweisen von SchülerInnen, die als Non-Standard-Formen wahrgenommen werden, während Julia Wohlgenannt auf Möglichkeiten eingeht, language awareness, d.h. das Bewusstsein von SchülerInnen (und Lehrenden) für unterschiedliche Sprachen und Sprachformen, zu fördern. In der Schule geht es nicht nur um das Lernen von Sprachen im traditionellen Sinn, sondern auch darum, SchülerInnen mit ihrem gesamten sprachlichen Repertoire wahrzunehmen. Dies geschieht mittels längerfristiger Unterrichtsprinzipien und Projektarbeiten von kürzerer Dauer. Stefan Pernes widmet sich einem konkreten, mittlerweile langjährigen Projekt in einer Wiener Volksschule, während Claudia Kral eine Analyse der Effekte und Möglichkeiten von Projektarbeiten anstellt. Ideen für eine andere, sprachenfreundliche Schule wurden diskutiert, seit die Institution Schule besteht, und in der Reformpädagogik, in Alternativschulen oder in Form von Unterrichtselementen umgesetzt – manches hat sich durchgesetzt und anderes bedarf stetiger Wieder-Einforderung. Die Anerkennung und Wahrnehmung der Sprachen von SchülerInnen (und Lehrenden) ist nach wie vor umkämpftes Terrain, während zur selben Zeit in vielen Klassenzimmern und Forschungsprojekten immer breiteres Wissen und ein großer Erfahrungsschatz zum Thema entstehen. Judith Purkarthofer und Brigitta Busch stellen Fragen zur Mehrsprachigkeit in Schulen, indem sie praktische Erfahrungen zusammen mit theoretisch-methodologischen Diskussionen der Angewandten Sprachwissenschaft denken. Aus den unterschiedlichen Erfahrungen der Forschenden und Lehrenden, die u.a. in diesem Band versammelt sind, ergeben sich Einstiege – Ideen gelebter Heteroglossie, die weitergedacht und in den verschiedenen Kontexten weiter verhandelt werden können. Redaktion Judith Purkarthofer, Brigitta Busch AutorInnen Brigitta Busch, Univ.-Professorin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien. Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt Mehrsprachigkeitsforschung, zunächst in Kärnten, dann im Raum des früheren Jugoslawien und derzeit vor allem in Wien und in Südafrika. Isabella Hörbe, Absolventin des Bachelors Sprachwissenschaft Claudia Kral, Sprachwissenschafterin in Wien. Arbeitet mit Raum in vielen Facetten, mit Sprache und Kindern. Stefan Pernes, Absolvent des Masterstudiums Angewandte Linguistik, Universität Wien Judith Purkarthofer, Forschungsgruppe Spracherleben, Universitätsassistentin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien. Arbeitet mit SprecherInnen und Sprachen in und um Schulen. Martina Rienzner, Mitarbeiterin im Forschungsprojekt PluS – Plurilingual Speakers in Unilingual Environments an der Universität Wien, arbeitet zum Umgang mit Mehrsprachigkeit in Behörden- und Gerichtskontexten. Im Rahmen der Einrichtung des muttersprachlichen Unterrichts in Somali hat sie einen Ausflug in die Schulwelt gemacht. Christian Schreger, Mehrstufenklassenlehrer mit freinetpädagogischem Schwerpunkt. Zahlreiche Preise für Projekte wie „WeltABC“, „Kleine Bücher“, „Digitales Tagebuch“. Mitarbeit am „Arbeitskreis Migration“ am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien. Julia Wohlgenannt, Sprachwissenschaftlerin und Volksschullehrerin in Wien Cora Zölss, Volksschuldirektorin der zweisprachigen Volksschule Großwarasdorf.Arbeitet mit Kindern, Eltern und PädagogInnen mit verschiedenen Sprachhintergründen: Burgenlandkroatisch, Ungarisch, Deutsch, Marija Zvonarits-Karall, war 18 Jahre lang Schulleiterin einer einklassigen und zweisprachigen Volksschule – mit viel Liebe für „Sprachen und Kinder“ und ist Mutter von 4 Töchtern, die ihr täglich etwas Neues beibringen. Studienverlag: Schulheft 151Klappentext

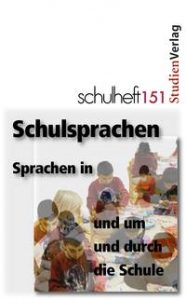 Schulischer Alltag ist mehrsprachig. Manchmal wird diese Mehrsprachigkeit als großer Gewinn und sehr erstrebenswertes Ziel gesehen, manchmal aber auch als Belastung und Hindernis. Je nach Situation bemühen sich Lehrende und SchülerInnen, manche Sprachen intensiv zu fördern und einzufordern, während sie andere vermeiden oder schlicht vergessen, auch wenn diese im außerschulischen Leben eine große Rolle
Schulischer Alltag ist mehrsprachig. Manchmal wird diese Mehrsprachigkeit als großer Gewinn und sehr erstrebenswertes Ziel gesehen, manchmal aber auch als Belastung und Hindernis. Je nach Situation bemühen sich Lehrende und SchülerInnen, manche Sprachen intensiv zu fördern und einzufordern, während sie andere vermeiden oder schlicht vergessen, auch wenn diese im außerschulischen Leben eine große Rolle
spielen.Inhalt
Einleitung und Zielsetzung
Die gespaltene Zunge
Überblick über die Bedingungen des Minderheitenschulwesens – am Beispiel einer mehrsprachigen Kleinschule
Servus! Zdravo! Szia! Hello! Eltern und Kinder als Beteiligte am mehrsprachigen Minderheitenschulwesen
„Platz machen“ und Schule (mit)gestaltenMuttersprachlicher Unterricht in Somali
Forschende Schulen und geschulte Forschende – Ein Weg zur Schulentwicklung
Das Kleine Buch vom Elefanten und der Maus: Viele Stimmen und Sprachen in einen Dialog bringen
„und es klingt in meinen Ohren (-) wie eine Dissonanz. (-)" Die Ideologie der Standardsprache am Beispiel einer Interview-Analyse
Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer: Zum Einsatz von Sprachbewusstheit und Language Awareness in der Volksschule
Die große Freiheit der Kleinen Bücher
Eine Schulgeschichte. Verdichtete Erlebnisse von Lehrenden und Lernenden
Wahrnehmungen in der mehrsprachigen Schule – ein Vor-Nachwort.
Nachwort: Abschied vom Ideal der HomogenitätVorwort
AutorInnen
Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Albanisch …Bestellen