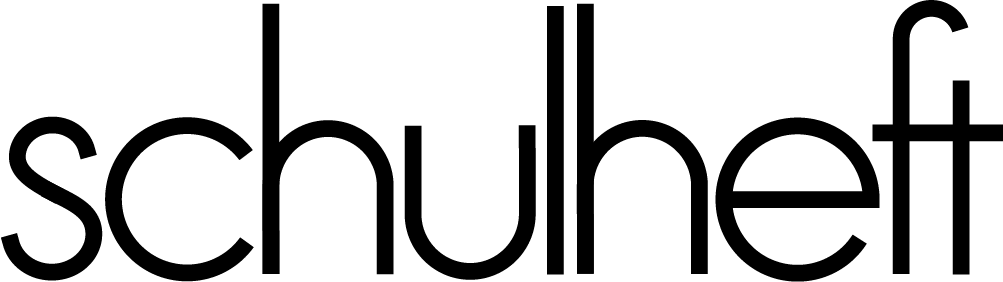Alphabetisierung und Basisbildung
Otto Rath Ferdinand Eder Monika Tröster Bettina Rossbacher Annemarie Saxalber-Tetter Antje Doberer-Bey Monika Ritter Christina Gabriel Statement des BM:UKK Eveline Christof Erich Ribolits Daniela Holzer Alfred Berndl So wie in anderen europäischen Industriestaaten muss auch in Österreich eine sehr große Zahl von Menschen (bis zu 1 Million) als "funktionale Analphabet/innen" bezeichnet werden. Diese Menschen haben in den "Kulturtechniken", Lesen, Schreiben, Rechnen und Informationstechnologien, derart große Schwächen, dass sie nicht einmal die diesbezüglichen Mindestanforderungen, die im Alltag oder in einfachen beruflichen Tätigkeiten an sie gestellt werden, ausreichend erfüllen können. Allerdings wird diese Tatsache gerade in Österreich weitgehend tabuisiert und, wenn überhaupt, dann nur in einer populistisch-verzerrten Form - z.B. im Zusammenhang mit den diesbezüglichen Hinweisen aus den PISA-Untersuchungen, als ein durch die vorgeblich übergroße Zahl von Migrant/innen verursachtes Problem - diskutiert. Ganz in diesem Sinn bewegen sich auch bildungspolitische Maßnahmen, die den Betroffenen als Unterstützung angeboten werden, in Dimensionen, die, angesichts der Größe des Problems, geradezu als lächerlich bezeichnet werden müssen. Letztendlich werden hierzulande nicht einmal ausreichende Anstrengungen unternommen, um das Problem in seiner quantitativen und qualitativen Dimension ausreichend erfassen und systematische Schritte zu seiner Reduzierung unternehmen zu können. Das vorliegende schulheft greift das Problem der alarmierend hohen Zahl von funktionalen Analphabet/innen auf, fragt nach Hintergründen und Zusammenhängen, analysiert die verfügbaren Fakten und setzt diese in Beziehung zur österreichischen (Bildungs-) Politik in den Bereichen von Schule, Aus- und Weiterbildung. Aktuelle Programme zur Bekämpfung nicht ausreichend gegebener Basisbildung werden präsentiert und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen analysiert. Außerdem wird die österreichische Situation sowohl hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Dimensionen des Problems als auch hinsichtlich der bildungspolitischen Maßnahmen mit der in anderen europäischen Ländern verglichen. In vier Bereiche gegliedert widmen sich die Beiträge der Autor/innen, die alle höchst unterschiedliche Zugänge zum Thema haben, dem im ersten Anschein paradox erscheinenden Phänomen einer mangelnden Basisbildung in einer Gesellschaft, in der Wissen und Bildung zu zentralen Größen geworden sind. Es werden die Problemlage und deren Hintergründe dargestellt, es werden Programme und Maßnahmen vorgestellt sowie gesellschaftliche Hintergründe und ihr Zusammenhang mit Alphabetisierung und mangelnder Basisbildung beleuchtet. Zwischen den einzelnen Beiträgen befinden sich Texte, die im Rahmen von Basisbildungskursen von Teilnehmer/innen verfasst wurden. Sie geben sehr anschaulich und authentisch Einblick in die verschiedenen Facetten der Problematik, als Analphabet/in in einer von Schrift dominierten Gesellschaft zu leben. In ersten Teil führt Otto Rath grundsätzlich in die Thematik ein, indem er Fakten zur begrifflichen Diskussion liefert und über Hintergründe, Größenordnung und Entstehung von Analphabetismus berichtet. Er spricht von einem gesellschaftlichen Problem, das nicht nur in Zusammenhang mit der Verwertbarkeit Einzelner auf dem Arbeitsmarkt diskutiert werden darf. Darüber hinaus stellt er das Netzwerk Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich als eine, nach seinem Dafürhalten, gelungene Initiative vor. Eine umfassende Analyse mangelhafter Basisbildung im Spiegel der PISA-Untersuchungen wird von Ferdinand Eder geliefert. Er plädiert für eine Verbesserung der Diagnoseinstrumente, um einem Mangel schon früh auf die Spur kommen zu können, und für einen Ausbau des Förderungssystems in Schulen, um einem Anwachsen des funktionalen Analphabetismus bei Erwachsenen entgegenwirken zu können. Monika Kastner präsentiert die Ergebnisse einer überaus interessanten qualitativen Studie zur Weiterbildungsbeteiligung benachteiligter Erwachsener. Sie stellt sich dabei Fragen nach Bildungswünschen und Bildungsanlässen sowie nach Zugängen zu Bildungsveranstaltungen und deren Barrieren. Im zweiten Teil ihres Textes stellt sie konkrete Programme und Maßnahmen vor, mit denen ihrer Meinung nach dem Problem des Analphabetismus bzw. mangelhafter Grundbildung begegnet werden soll. Monika Tröster berichtet über Fakten und Daten zu Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland; sie analysiert Rahmenbedingungen und Strukturen, Schwerpunkte in der Grundbildungsarbeit sowie Entwicklungstendenzen und Perspektiven. Speziellen österreichischen Initiativen im Zusammenhang mit der Thematik nehmen sich vier Autorinnen in ihren Beiträgen an. Annemarie Saxalber-Tetter setzt sich in ihrem Beitrag mit Zweitbzw. Fremdsprachlernen und muttersprachlichen Basiskompetenzen auseinander. Sie plädiert für ein Konzept einer integrativen Spracherziehung für Schüler/innen in ihrer Muttersprache (Herkunftssprache) und der Zweitsprache (Fremdsprache). Dies soll einerseits dazu beitragen die Identitätsbildung der Jugendlichen zu fördern und andererseits einen interkulturellen Dialog zwischen den am Schulgeschehen Beteiligten ermöglichen. Für Antje Doberer-Bey ist die Professionalität der Trainer/innen, die im Bereich des Basisbildungserwerbs Erwachsener mit mangelhaften Lese- und Schreibkompetenzen tätig sind, ein zentraler Faktor. Sie stellt dar, dass Basisbildung mit Erwachsenen eine Reihe von gesellschaftlichen und individuellen Bedingungen berücksichtigen muss, wenn sie Erfolg haben will. Die angebotenen Kurse müssen an Lebenswelten, Zielgruppen und an Gleichstellung genauso orientiert sein wie an der Förderung von Persönlichkeitsentwicklung und sozialer bzw. interkultureller Kompetenz, sie müssen auf Autonomie und Selbststeuerung abzielen und Kommunikationsfähigkeit sowie Problemlösungs- kompetenz vermitteln. Monika Ritter widmet sich in ihrem Beitrag dem Thema der Alphabetisierung mit Migrant/innen, wobei sie feststellt, dass für diese Zielgruppe eine Förderung von Schrift und Sprache gleichermaßen wichtig ist. Es werden Modelle der Alphabetisierung mit Migrant/innen vorgestellt, wobei Lernerorientierung, Ressourcenorientierung, Empowerment der Lernenden, Wertschätzung der Vielsprachigkeit der Lernenden sowie Authentizität und selbstbestimmtes Lernen zentrale Prinzipien in den angebotenen Kursen darstellen. Christina Gabriel stellt in ihrem Beitrag fest, dass der funktionale Analphabetismus bei autochthonen Roma im Burgenland im Kontext mit der marginalisierten Stellung der Volksgruppe innerhalb der Gesellschaft gesehen werden muss. Maßnahmen, die darauf abzielen, die Zahl der Analphabet/innen unter Roma zu verringern, müssen in jedem Fall auch auf eine Stärkung der Identität sowie auf eine Gleichstellung dieser Volksgruppe abzielen. Am Ende dieses Abschnitts findet sich ein Statement des BM:UKK, das, wie in der redaktionellen Vorbemerkung dargestellt wird, die Bedeutung widerspiegelt, die der veritablen Rate funktionaler Analphabet/innen hierzulande von Seiten der Politik eingeräumt wird. Im letzten Teil des vorliegenden schulhefts werden Zusammenhänge zwischen Analphabetismus und mangelnder Basisbildung und anderen relevanten gesellschaftlichen Tendenzen analysiert. Eveline Christof widmet sich dem oft verdeckten Zusammenhang zwischen den Themen Macht, Scham und Stigmatisierung bei mangelnder Basisbildung. Es wird dargestellt, wie diese Mechanismen funktionieren und zusammenwirken. Besonders hervorgehoben wird, dass Kurse, die Basisbildungsdefizite ausgleichen sollen, in jedem Fall auch eine Umdeutung des Selbstbilds der Betroffenen thematisieren müssen, um Abwertungstendenzen und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Erich Ribolits hinterfragt in seinem Beitrag das Ziel, welches mit Alphabetisierungsmaßnahmen und dem Erwerb ausreichender Basisbildungs- kompetenzen erreicht werden soll. Das Ziel der Grundbildungsmaßnahmen ist aus seiner Sicht aufgrund der eindimensionalen Ausrichtung allen organisierten Lernens an der Vernutzung menschlicher Arbeitskraft zu relativieren. Die Argumentation von Daniela Holzer geht in eine ähnliche Richtung: Sie kommt zum Schluss, dass die Entscheidung, sich der herrschenden Norm des lebenslangen Lernens zu widersetzen und sich nicht weiterzubilden, u.U. durchaus eine als klug zu charakterisierende Entscheidung sein kann. Im letzen Beitrag widmet sich Alfred Berndl dem wichtigen Thema der Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich von Basisbildung und Alphabetisierung. Da das Thema noch immer tabuisiert ist und die Betroffenen stigmatisiert sind, findet er es besonders notwendig, genau hier anzusetzen. Aufklärende Öffentlichkeitsarbeit, gut ausgebildete Alphabetisierungstrainer/innen, der Einsatz von "Agents of Change" sowie eine gezielte Bedürfnisorientierung sind seines Erachtens zentrale Momente, um ein Umdenken bei der Bevölkerung herbeizuführen und Betroffenen Mut zu machen, ihre Situation zu verbessern. Erich Ribolits Berndl Alfred Doberer-Bey Antje Eder Ferdinand Holzer Daniela Tröster Monika Studienverlag: Schulheft 131Klappentext

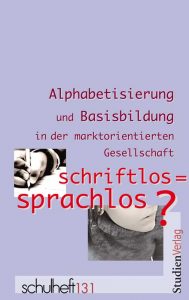 Wie in anderen europäischen Industriestaaten muss auch in Österreich eine große Zahl von Menschen als "funktionale AnalphabetInnen" bezeichnet werden. Diese Menschen haben in den "Kulturtechniken", Lesen, Schreiben, Rechnen und Informationstechnologien, derart große Schwächen, dass sie nicht einmal die diesbezüglichen Mindestanforderungen, die im Alltag oder in einfachen beruflichen Tätigkeiten an sie gestellt werden, ausreichend erfüllen können.
Wie in anderen europäischen Industriestaaten muss auch in Österreich eine große Zahl von Menschen als "funktionale AnalphabetInnen" bezeichnet werden. Diese Menschen haben in den "Kulturtechniken", Lesen, Schreiben, Rechnen und Informationstechnologien, derart große Schwächen, dass sie nicht einmal die diesbezüglichen Mindestanforderungen, die im Alltag oder in einfachen beruflichen Tätigkeiten an sie gestellt werden, ausreichend erfüllen können.
Das vorliegende schulheft greift dieses Problem auf, fragt nach Hintergründen und Zusammenhängen und setzt diese in Beziehung zur österreichischen (Bildungs-)Politik in den Bereichen von Schule, Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus werden Programme zur Bekämpfung nicht ausreichend gegebener Basisbildung präsentiert und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen analysiert.Inhalt
Hintergründe und Problemlagen
Basisbildung und Alphabetisierung Erwachsener: Vom tabuisierten Thema zur Selbstverständlichkeit
Die Diskussion um mangelnde Basisbildung Erwachsener
Mangelhafte Basisbildung im Spiegel der PISA-Untersuchungen
Monika Kastner
Zugänge zur Grundbildung: Teilnahme als Teilhabe
Programme und Maßnahmen
Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland
Zur Bedeutung der Basisbildung Initiativen in Österreich
Zweit- und Fremdsprachlernen und muttersprachliche Basiskompetenzen.
Die Professionalität der Trainer/innen - zentrales Element in der Basisbildung und Alphabetisierung mit Erwachsenen
Alphabetisierung mit MigrantInnen
Funktionaler Analphabetismus bei autochthonen Roma im Burgenland
Basisbildung/AlphabetisierungGesellschaftliche Zusammenhänge
Macht, Scham, Stigmatisierung bei mangelnder Basisbildung - ein verdeckter Zusammenhang
Wer bitte sind hier die Bildungsfernen?
Über die kluge Entscheidung, sich nicht weiterzubilden
Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit in der Basisbildung und AlphabetisierungVorwort
AutorInnen
Redaktion
Michael Sertl
Johannes ZuberAutorInnen
Dipl.Päd., seit 2003 bei der ISOP GmbH im Themenbereich Basisbildung und Alphabetisierung Erwachsener tätig
Christof Eveline
Dr., Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, Forschungseinheit Aus- und Weiterbildungsforschung
Leitung der Lehrgänge zur "Ausbildung von Alphabetisierungs- und BasisbildungspädagogInnen". Entwicklung von Qualitätsstandards, Berufsbild und Weiterbildungskonzept für die Basisbildung, derzeit freie Mitarbeit im ESF-Projekt In.Bewegung IIj
Gabriel Christina
Mag., Projektassistentin im Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Studium der Indologie und Finno-Ugristik sowie Pädagogik
Univ.-Prof. Dr., Universität Salzburg, Erziehungswissenschaftler und Kultursoziologie
Kastner Monika
Univ.-Ass. Dr., Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung
Mag. Dr., Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz, Arbeitsbereich Weiterbildung
Rath Otto
Mag., Bildungsmanager, Gesamtkoordinator des Projekts"In.Bewegung - Netzwerk Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich"
Ritter Monika
Pädagogische Leiterin AlfaZentrum für MigrantInnen
Ribolits Erich
Univ.-Prof. Dr., Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, Aus- und Weiterbildungsforschung
Rossbacher Bettina
Mag., Referentin für Bildung und Wissenschaft in der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK)
Saxalber-Tetter Annemarie
Univ.-Prof. Dr., Universität Klagenfurt, Institut für Germanistik, stellvertretende Leitung der Abteilung für Deutschdidaktik
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE)Bestellen