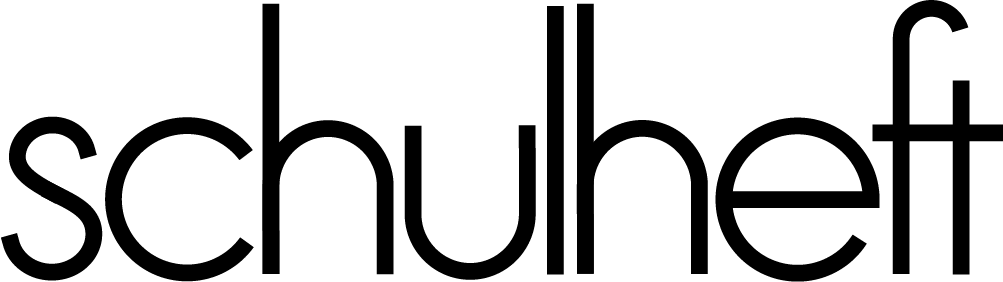Anders lesen lernen
Anna-Maria Adaktylos/Judith Purkarthofer Corinna Salomon John Rennison Ewelina Sobczak Anna-Maria Adaktylos/Liliana Madelska Birgit Springsits Maria Götzinger-Hiebner Werner Mayer Judith Purkarthofer Linn Sükar-Kogler Angelika Hrubesch Niku Dorostkar Wie lernen Kinder lesen? Wie lernen Erwachsene lesen? Der Erwerbder Schriftsprache ist manchmal ganz einfach und manchmal sehr schwierig. Manche Kinder lernen fast von selbst im Kindergarten lesen, manche bleiben bis ins Erwachsenenalter ungeübte Leser. In jedem Fall ist das Lesen- und Schreibenlernen eine große Herausforderung sowohl für die Erwerbenden als auch für die Lehrenden und damit auch für Institutionen und Kurse. Besonders die PISA-Tests mit den verheerenden Ergebnissen zum Leseverständnis österreichischer Schülerinnen und Schüler rücken die Problematik wieder ins Blickfeld selbst der Massenmedien. Noch schwieriger wird die Situation des Lesen- und Schreibenlernens, wenn gleichzeitig zur neuen Schrift auch eine neue Sprache erworben oder erlernt wird. Kinder, die mit ihren Eltern andere als die Schulsprachen sprechen, erwerben gleichzeitig mit der neuen Schulsprache auch die neue Kulturtechnik, die ihnen in ihrem weiteren Schulverlauf Zugang zu allem möglichen Wissen gewähren soll. Unbestritten liegt im Erwerb der Schriftsprache große gesellschaftliche Relevanz, dient sie doch neben ihrer unterhaltenden und informativen Funktion vor allem auch dazu, mit einer größeren Öffentlichkeit und staatlichen wie gesellschaftlichen Institutionen in Kontakt zu treten. Um der eigenen Stimme also Gehör zu verschaffen, bedarf es immer wieder der Fähigkeit, diese Stimme in Schrift umzusetzen. Um die Stimme anderer zu hören, muss man fähig sein, Schrift zu entziffern, um den Sinn des Geschriebenen zu erfassen. Der vorliegende Band soll sowohl PraktikerInnen als auch WissenschaftlerInnen neue Perspektiven auf das vermeintliche Problem des Lesenlernens eröffnen. Dazu richten die AutorInnen ihren Blick auf verschiedene Lernsituationen und Altersgruppen und beschäftigen sich mit dem Umfeld von Schrift und Diskurs. Eine theoretische und historische Betrachtung von verschiedenen Schriftsystemen bietet Corinna Salomons Artikel. Sie stellt dar, aus welchen Bedürfnissen von Sprechenden sich Schriften entwickeln und mit welchen Mitteln, Zeichen oder Systemen Sprache und/oder Bedeutung festgehalten werden können. Daran anschließend entwirft John Rennison eine alternative, nicht ganz ernstgemeinte neue deutsche Rechtschreibung – was wäre, wenn das Deutsche noch nicht verschriftet worden wäre? Ewelina Sobczak blickt in den Kindergarten und gibt in ihrem Artikel Anregungen, wie Kindern schon vor Beginn des „offiziellen“ Lesenlernens Schrift und Schreiben näher gebracht werden können. Speziell geht sie auf die Situation mehrsprachiger Kinder ein, die neben anderen Familiensprachen Deutsch als Bildungssprache erleben und später in der Schule in dieser alphabetisiert werden. Von den ersten Schrifterfahrungen mehrsprachiger Kinder noch vor Beginn des Lesenlernens in der Schule berichtet Birgit Springsits. Sie zeigt anhand ihrer Beispiele, wie Kinder erste Schrifterfahrungen machen, welche Vorstellungen sie über Schrift haben und wie sie den Zusammenhang zwischen Schreiben und Vorlesen herstellen. Das Erleben von Schulsprachen und die Haltungen der Kinder zu ihren verschiedenen Sprachen stehen im Mittelpunkt des Beitrags von Judith Purkarthofer über mehrsprachige Volksschulen in Kärnten und im Burgenland. Der Zusammenhang zwischen dem Hören und dem Lesen wird aus mehreren Perspektiven betrachtet: Anna-Maria Adaktylos und Liliana Madelska stellen eine Methode vor, wie mehrsprachigen Kindern mithilfe von einfachen, aber theoretisch fundierten Übungen das vollständige lautliche System des Deutschen vermittelt werden kann, sodass ihnen der Einstieg in die alphabetische Schrift erleichtert wird. Maria Götzinger-Hiebner beschreibt aus ihrer Erfahrung eine Methode des Erstlesens und Erstschreibens, die praxisorientiert zum Leseverständnis führt. Linn Sükar-Kogler berichtet aus ihrer Praxis von der Alphabetisierung fremdsprachiger Erwachsener und zeigt, wie das Lautieren hier als sinnvolle Methode genutzt werden kann, um den Weg von Lautketten zur Alphabetschrift zu ebnen. Die Kluft zwischen überkommenen Vorstellungen vom Lesen-/ Schreibenlernen und praxis- und theoriebasierten Erfahrungen stellt Werner Mayer dar. Er beschreibt die potenziellen Probleme des deutschsprachigen Leselehrgangs für mehrsprachige Volksschulkinder. Auch für Erwachsene hält der (teilweise erzwungene) Deutscherwerb vor allem in Verbindung mit dem Recht auf Aufenthalt in Österreich viele Probleme bereit. Angelika Hrubesch berichtet von der Situation Erwachsener in Alphabetisierungskursen in Wien und geht dabei sowohl auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie auch die Motivation der Teilnehmenden und Methoden des Unterrichts ein. Den Abschluss des Bandes bietet der Beitrag von Niku Dorostkar, der analysiert, wie Sprache und Sprachverwendung als Begriffe verwendet werden, um MigrantInnen-Feindlichkeit zu maskieren. Wir können also erkennen, dass Mehrsprachigkeit nicht automatisch ein Problem im Lesenlernen darstellt, sondern ein Anderssein. Wenn dieses Anderssein wahrgenommen wird, kann es als Bereicherung statt als Einschränkung gesehen werden. In dieser Variation und den Methoden, mit verschiedenen Bedürfnissen während des Lesenlernens umzugehen, liegen zusätzliche Chancen auch für Kinder, deren Erstsprache die Schulsprache ist. Menschen, die lesen und schreiben lernen, sind ein-, zwei- oder mehrsprachig, sie sind Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Wenn mehr Möglichkeiten angeboten werden, um auf die unterschiedlichen Lernstile, Vorkenntnisse und Interessen der verschiedenen Lernenden einzugehen, wird dies ohne Zweifel sehr schnell zu größeren Erfolgen führen. Anna-Maria Adaktylos und Judith Purkarthofer Anna-Maria Adaktylos Anna-Maria Adaktylos, Mag.a phil., ist Sprachwissenschaftlerin und lebt in Wien. Studienverlag: Schulheft 143Klappentext

Anders lesen lernen. Lesen und schreiben lernen mit Deutsch als Zweitsprache
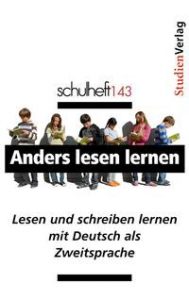 Wie lernen Kinder lesen? Wie lernen Erwachsene lesen? Der Erwerb der Schriftsprache ist manchmal ganz einfach und manchmal sehr schwierig – in jedem Fall ist er eine große Herausforderung sowohl für die Erwerbenden als auch für die Lehrenden und damit auch für Institutionen und Kurse. Noch schwieriger wird die Situation, wenn gleichzeitig zur neuen Schrift auch eine neue Sprache erworben oder erlernt wird.
Wie lernen Kinder lesen? Wie lernen Erwachsene lesen? Der Erwerb der Schriftsprache ist manchmal ganz einfach und manchmal sehr schwierig – in jedem Fall ist er eine große Herausforderung sowohl für die Erwerbenden als auch für die Lehrenden und damit auch für Institutionen und Kurse. Noch schwieriger wird die Situation, wenn gleichzeitig zur neuen Schrift auch eine neue Sprache erworben oder erlernt wird.
Das vorliegende schulheft eröffnet für PraktikerInnen und WissenschafterInnen neue Perspektiven auf das Lesenlernen. Dazu richten die AutorInnen ihren Blick auf verschiedene Lernsituationen und Altersgruppen und beschäftigen sich mit dem Umfeld von Schrift und Diskurs.Inhalt
Vorwort
Schriftgeschichte und Schrifttypologie
Ideen zu einer deutschen Rechtschreibreform
Frühe Literalität im Kindergarten
Mehrsprachige Kinder:
Sprachliche Vorbereitung auf das Lesen- und Schreibenlernen im Deutschen
(K)ein unbeschriebenes Blatt
Kinder auf ihren Wegen zur und mit Schrift begleiten
Lesen ist langweilig – oder?
Gedanken zum Erstlesen und Erstschreiben
Mind the Gap!
Literalitätserwerb in der Zweitsprache Deutsch
Zweitsprache Deutsch?
Zum Erleben von Sprachen in mehrsprachigen Volksschulen
Das Lautieren als "All-inclusive"-Methode bei der Erst-Alphabetisierung fremdsprachiger Erwachsener
Ein Bericht aus der Praxis
Lesen und Schreiben und Deutsch lernen
Alphabetisierung mit erwachsenen MigrantInnen
Mehrdeutige Mehrsprachigkeit
Der österreichische Diskurs über Sprache im sprachenpolitischen KontextVorwort
AutorInnen
Redaktion
Judith PurkarthoferAutorInnen
Niku Dorostkar, MMag. phil., ist Dissertant und Projektmitarbeiter am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien.
Maria Götzinger-Hiebner, Mag.a, arbeitet in freier Praxis und an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Angelika Hrubesch, Mag.a phil., ist Leiterin des AlfaZentrums für MigrantInnen (www.alfazentrum.at), Mitglied im Vorstand des Österreichischen Verbands für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (ÖDaF, www.oedaf.at) und Sprecherin des Netzwerks SprachenRechte (www.sprachenrechte.at).
Liliana Madelska, Dr., ist Sprachwissenschaftlerin, Polonistin und Logopädin und arbeitet am Institut für Slawistik der Universität Wien (www.lilianamadelska.com).
Werner Mayer arbeitete als Grundschullehrer und -leiter in Wien und war am Aufbau des Sprachförderzentrums Wien beteiligt.
Judith Purkarthofer, Forschungsgruppe Spracherleben, Doktorandin zum Thema mehrsprachige Schulen am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
John Rennison, ao. Univ.-Prof., arbeitet am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien.
Corinna Salomon, Mag., arbeitet als Pre-doc-Assistentin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien.
Ewelina Sobczak, Mag.a, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, Forschungsschwerpunkte: Spracherwerbs-, Mehrsprachigkeits- und Migrationsforschung.
Birgit Springsits, Mag.a, arbeitet am Institut für Germanistik der Universität Wien im Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Linn Sükar-Kogler, Mag.a phil., arbeitet als Kursleiterin von Alphabetisierungskursen und "Mama lernt Deutsch"-Kursen beim Verein Station Wien.Bestellen