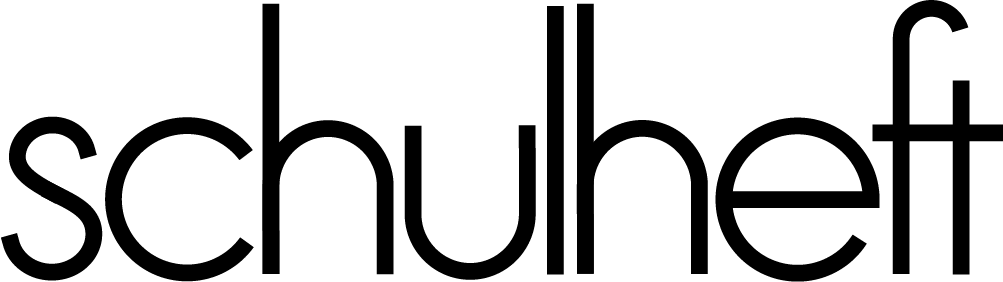Exklusiv, elitär und vertikal
Das vorliegende schulheft will aufzeigen, inwieweit der Bildungsbereich von der neoliberalen Konkurrenzwirtschaft betroffen wird. Es liefert dazu konkrete Informationen, Länderbeispiele und eine kritische Betrachtung offizieller Darstellungen der EU. Das schulheft möchte auch auf denkbare Alternativen aufmerksam machen. Ein Rückblick: Elke Gruber, Erich Ribolits Gerald Oberansmayr Solidarwerkstatt Österreich Johannes Gruber Isabelle Voltaire Ulla Klötzer Bernhard Golob, Berthold Gubi, Petra Radeschnig Claudia Schmied Rezensionen Seit Beginn der schulhefte bis heute entspricht es dem Selbstverständnis der HerausgeberInnen, gegen verkrustete, anachronistische Formen im Schul-Bildungsbereich Stellung zu nehmen und Reformen und Neuerungen einzufordern. Sehr früh wandten wir uns aber auch gegen neoliberale ‚Reformen’ im Zusammenhang mit der Entwicklung der Europäischen Union. Bereits vor 22 Jahren erschien die Nummer „Macht Liebe blind – Materialien zu Österreich-EG-Europa“ (57/1990). Prominenten Autoren wie z. B. Anton Pelinka und Peter Pilz befürchteten damals schon Neutralitäts- und Demokratieverluste im Zusammenhang mit einem EG-Beitritt Österreichs. ErziehungswissenschafterInnen wie Erich Ribolits, Peter Gstettner und Elke Gruber prognostizierten Veränderungen in der Bildungspolitik. Um an die kritischen Positionen von damals zu erinnern, übernehmen wir einen Auszug eines Beitrags von Erich Ribolits und Elke Gruber als Einstiegstext in die vorliegende Nummer. Das schulheft hat auch in den Folgejahren entsprechende Themen und Fragen aufgegriffen und versucht, Positionen gegen den Mainstream zu finden. Die Präsanz der heutigen Situation, gekennzeichnet durch Sparpaket und Schuldenbremse, Bildungsvolksbegehren und Bildungskrise, fordert neue Informationen, die wir in diesem schulheft liefern wollen. Grundsätzlich beschäftigt sich Gerald Oberansmayr unter dem Titel „Exklusiv, elitär und vertikal. EU und Bildungspolitik“ mit den Zusammenhängen der neoliberalen Transformation der Wirtschafts- und Sozialpolitik durch die und in der EU mit den bildungspolitischen Veränderungen in den Mitgliedsstaaten. Er benennt die Lobbyorganisationen und deren Macht- und Zielsetzungen, ihren Einfluss an den Universitäten, auf Strukturen und Inhalte. Die Folgen von Bolognaprozess und Lissabonstrategien werden aufgezeigt. Entgegen propagandistischen Behauptungen entwickelt sich ein Zweiklassen-Studium, dominiert von Unternehmensinteressen: teure Eliten- und billige Massenbildung. Die Finanzierung öffentlicher Bildungseinrichtungen unterliegt immer mehr dem Sparwahn. Entgegen untadeligen Absichtserklärungen verlaufen Hierarchisierung, Liberalisierung und Privatisierung im Bildungsbereich parallel zu diesen Entwicklungen in anderen Bereichen. Öffentliche Budgets stehen unter einem enormen Druck, wobei ganz besonders in wirtschaftlich schwächeren Länder der EU, die immer mehr unter Kuratel gestellt werden, öffentliche Bildungseinrichtungen schrumpfen. Kostenlos soll letztlich nach EU-Vorgaben nur der öffentliche Grundschulsektor bleiben. Kürzungen im Bildungsbereich hängen eng mit sozialer Armut zusammen, denn in der EU wächst die Kluft nicht nur wirtschaftlich zwischen Peripherie und Zentrum, auch die Mittel für Bildung klaffen immer weiter auseinander. Bildungsressourcen wandern in die reichen Zentren – ein imperiales Herrschaftsmuster innerhalb der EU und nach außen. Oberansmayrs Blick auf die österreichischen Verhältnisse vor allem nach dem Hochschulgesetz 2002 legt ein Musterschülerverhalten dem EU-Diktat gegenüber offen. Banken und Konzerne übernahmen die Kontrolle in den Uni-Räten. Seit 1995 gab es laufend Einsparungen im Bildungsbereich, verschärfte sich der soziale Numerus Clausus und boomten private Einrichtungen. Eine festgeschriebene Schuldenbremse fungiert auch als Bildungsbremse und das Zulassen von EU-Kontrollmechanismen reguliert zunehmend die Spielräume einer demokratischen Bildungspolitik. Gerald Oberansmayr untermauert seine Analyse durch Quellenmaterial und Literaturhinweise. Wer solche Entwicklungen aufzeigt und damit den ideologischen Schleier, den Politiker und Medien darüber legen, lüftet, muss sich folgerichtig auch der Frage nach Alternativen stellen. Dies tut der Autor im Anhang an seinen Artikel als Mitglied der „Solidarwerkstatt Österreich“, einer Initiative, die beständig daran arbeitet, Informationen zu liefern und Alternativen zu entwickeln. Um den Blick auf Zusammenhänge der Bildungspolitik von der nationalen und der EU-Ebene zu erweitern, erhielten wir Beiträge aus der Schweiz, aus Frankreich und Finnland. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen ist daraus ein gemeinsamer Nenner der Betroffenheit erkennbar. Der Schweizer Soziologe Johannes Gruber informiert über Entwicklungen im Zusammenhang mit dem „Weissbuch. Zukunft Bildung Schweiz“, dessen Ziel es ist, die Schweiz bis 2030 zur „Wissensgesellschaft“ zu machen. Nun ist die Schweiz zwar kein EU-Land, aber doch vehement durch den „Import der europäischen Bildungsentwicklungslogik“ mit den in der EU laufenden Prozessen verbunden und an der Bolognareform und anderen Abkommen beteiligt. Johannes Gruber kritisiert den Begriff „Wissensgesellschaft“ sowohl aus einer historischen Dimension als auch im Zusammenhang mit dem Neoliberalismus. Er beschreibt den Wandel des Bildungsverständnisses. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Menschen und die Anpassung an die Bedürfnisse der Kapitalmacht stehen im Vordergrund. Die Zusammenarbeit von Einrichtungen des öffentlichen Sektors mit der Geschäftswelt soll zur Vermittlung unternehmerischen Denkens beitragen. Der Autor schließt sich der Einschätzung Konrad Paul Liessmanns an, derzufolge nicht mehr der Wahrheitsbezug des Wissens im Mittelpunkt steht, sondern dessen Bedeutung für Effizienz, Verwertbarkeit, Kontrolle, Spitzenleistung und Anpassung. Gruber zieht die Schlussfolgerung, dass die EU-europäischen Bildungsreformen „Unbildung“ erzeugen. Die Autoren des „Weissbuchs“ fühlen sich weitgehend der Humankapitallogik verpflichtet. Es gibt zwar darin durchaus zutreffende Diagnosen und sinnvolle Forderungen, durch die Einbettung der sinnvollen Anliegen in die Wissensgesellschaftsdebatte sind sie aber insofern ambivalent, als Reformen nicht aus Gerechtigkeitsgründen eingemahnt werden, sondern die Minderung des ökonomischen Potentials der Schweiz verhindern sollen. In der öffentlichen Diskussion greift die Konkurrenzlogik derart, dass man sich nicht um emanzipatorische Entwicklungen kümmert. Frankreich ist traditionell ein Land mit einer extremen Kluft zwischen Elite- und Massenausbildung, zwischen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Isabelle Voltaire stellt zu Beginn ihres Beitrags die Entwicklung der Inhalte und Methoden an Schulen und Universitäten in den Mittelpunkt. Schon seit den 70er Jahren verfällt die Fähigkeit der SchülerInnen, Wahrheiten zu erkennen, Meinungen und Stellungnahmen zu entwickeln, Haltungen einzunehmen, die sich an ‚falsch’ und ‚richtig’ orientieren. Es wird nur reproduziert, Angebote und Rezepte werden ohne Reflexion aus dem Internet angenommen, Hauptsache, man passt sich an und erzielt gute Ergebnisse. In Österreich greift diese Einschränkung und Entmündigung bereits, so z. B. im Zusammenhang mit der Zentralmatura. Der Beitrag von Isabelle Voltaire versucht, Begründungen für diese Erscheinungen zu finden. Personen, die nicht gelernt haben, Wahres und Falsches zu beurteilen, zu diskutieren, sind leichter zu lenken, werden Ja-Sager, suchen nur den Erfolg guter Noten und guter Testergebnisse. Offizielle Themen werden sorgfältig konstruiert, damit sie einfach zu einem erfolgreichen Prüfungsabschluss führen. Die Autorin ortet den Einfluss der Ideologen der ‚Postmoderne’ auf Wissenschaft und Politik. Das Maastricht-Programm fördert den Handel und das Geschäft mit Bildung. Die Angriffe gegen die öffentliche Schule, ihre Demontage, die Einsparungen bei Geldzuwendungen und Personal treiben Kinder von Familien, die es sich leisten können, in Privatschulen. Pädagogische Gründe werden vorgeschoben, wenn finanzielle Einsparungen im Vordergrund stehen. Ein Beispiel dafür ist die Aufhebung der Klassenwiederholung. LehrerInnen in Frankreich, eher links sensibilisiert, fühlen sich schuldig und werden als reaktionär verleumdet, wenn sie sich dem Qualitätsverlust des Unterrichts widersetzen. Der Artikel bietet zum Schluss eine Lösung an, die uns an Endzeitstimmung gemahnt: Inseln schaffen, wie die letzten Menschen in „Fahrenheit 451“, die wieder heimlich lesen. Finnlands Schulsystem ist allgemein der Inbegriff von fortschrittlicher Schule, ausgewiesen auch durch die Ergebnisse der Pisa-Studie. Ulla Klötzer sieht das aber als Verdienst einer Zeit, in der Finnland seine Wohlfahrtsstaatlichkeit entwickeln konnte. Sie hat aber schon im schulheft 113/2004 „Wa(h)re Bildung“ geschrieben, dass die mustergültige Anpassung an die EU-Forderungen tiefe Kerben in die reale soziale und ökonomische Realität geschlagen hat. Schulsterben und Aushungerung sozialer Einrichtungen nehmen auch in Finnland bedrohliche Formen an. Wie geht man nun in Österreich mit Informationen über die EU um? Welche Bilder und Aussagen werden uns geliefert? Die AutorInnen Bernhard Golob, Berthold Gubi und Petra Radeschnig überprüfen unter dem Titel „Als großartiges Friedensprojekt weitgehend unumstritten. Die Darstellung der EU in österreichischen Schulbüchern“ ihre Annahme, dass Schulbücher objektiv und unparteiisch sein und zum kritischen Denken anregen sollten. Außerdem dürften sie sich nicht in kontroversiell diskutierten politischen Fragen verherrlichend auf eine Seite stellen. Was ist das Resultat ihrer Untersuchung? Schulbücher bieten ein weitgehend einseitiges Bild der EU, das aus vielen schönen Schlagwörtern und Überschriften, aus bunten Strukturgrammen und Schautafeln besteht, in denen viele reale Probleme, Widersprüche und Kritikpunkte umschrieben oder glatt unterschlagen werden. Die Beispiele aus den Büchern sind, wenn nicht nur beschönigend, so glatte Verkehrungen der Realität und manchmal von peinlicher Verlogenheit. Erschreckend offenbart sich die Richtigkeit dieser Kritik auch am Beispiel der Rede der Ministerin Claudia Schmied, die noch viel mehr Freiheit zu Pathos und Beliebigkeit in Anspruch nimmt, als das Schulbuch es kann. Sollte das der heutigen Auffassung von politischer Bildung entsprechen, dann können wir uns voll inhaltlich den Bedenken von Isabelle Voltaire anschließen, dass die Wahrheit in Verruf gekommen und nur mehr in kleinen Lesezirkeln zu finden ist. Redaktion Elke Renner Grete Anzengruber AutorInnen Eveline Christof, Mag. Dr., Assistentin an der Universität Innsbruck, Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung Bernhard Golob, Mag., AHS-Lehrer in Wien Elke Gruber, Univ.-Prof., Lehrstuhl für Erwachsenen- und Berufsbildung am Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Universität Klagenfurt Johannes Gruber, Dr., Soziologe, Universität Basel und St. Gallen, Herausgeber Gewerkschaftszeitung vpod, Zeitschrift Bildungspolitik Berthold Gubi, Mag., AHS-Lehrer in Wien Ulla Klötzer, Lehrerin in Helsinki Gerald Oberansmayr, Mag., Aktivist der Solidarwerkstatt Österreich, Linz Petra Radeschnig, Organisationsberaterin, Wien Erich Ribolits, Bildungswissenschafter, Privatdozent an verschiedenen österreichischen Universitäten Claudia Schmied, Dr., Bundesministerin im Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Isabelle Voltaire, Lehrerin, Association familiale laique, Paris Studienverlag: Schulheft 145Klappentext

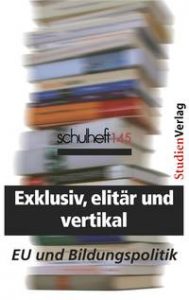 Tabuisierung, Vertuschung und Propaganda verbergen weitgehend die realen Machtverhältnisse in der Europäischen Union. Das Informationsdefizt erschwert eine fundierte Kritik und die Entwicklung von Alternativen. Große Teile der Bevölkerung leiden an den Folgeerscheinungen der mächtigen Konkurenzwirschaft und Konkurenzgesellschaft und orientieren sich oft in ohnmächtiger Skepsis an rechtsgerichteten Demagogen.
Tabuisierung, Vertuschung und Propaganda verbergen weitgehend die realen Machtverhältnisse in der Europäischen Union. Das Informationsdefizt erschwert eine fundierte Kritik und die Entwicklung von Alternativen. Große Teile der Bevölkerung leiden an den Folgeerscheinungen der mächtigen Konkurenzwirschaft und Konkurenzgesellschaft und orientieren sich oft in ohnmächtiger Skepsis an rechtsgerichteten Demagogen.Inhalt
...weil ich dort was Rechtes lern’
In Ost- und Westeuropa – Bildung als Anhängsel der Wirtschaft
Ein Beitrag aus dem schulheft 57/1990
Exklusiv, elitär und vertikal. EU und Bildungspolitik
Es gibt Alternativen!
Mit dem Weissbuch „Zukunft Bildung Schweiz“ in die „Wissensgesellschaft“
Was aus der französischen Schule geworden ist
Finnland ist kein Schulparadies
„Als großartiges Friedensprojekt weitgehend unumstritten“
Die EU in österreichischen Schulbüchern
Rede der Bundesministerin bei der Veranstaltung „Bildung im europäischen Kontext“ beim Europa Club Wien
Erich Ribolits: Bildung – Kampfbegriff oder Pathosformel. Über die revolutionären Wurzeln und die bürgerliche Geschichte des Bildungsbegriffs
Werner Lenz: Wertvolle Bildung. Kritisch – skeptisch – sozialVorwort
AutorInnen
Bestellen