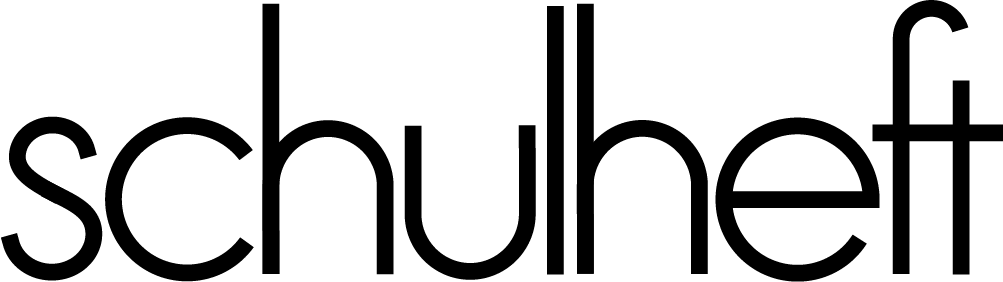Jugendkultur in der Krise
Inhalt Agnieszka Czejkowska Zorica Rakić Natalia Waechter Philipp Ikrath Rosa Reitsamer Harti Oberkofler Zorica Rakić Michael Rittberger Zorica Rakić Thomas Northoff Michael Rittberger Jugendkultur in der Krise? Dies war die Ausgangsfrage, der in dieser Nummer der schulhefte nachgegangen werden sollte. Eine Ausgangsfrage, die viele Fragen nach sich zog, deren mögliche Beantwortung nur im Zusammenhang mit den vielfältigen Antworten der Jugendlichen selbst zu leisten ist. Der Schwerpunkt bezieht sich auf Jugendkulturen, die sich nach 2008 generierten, dass allerdings die Krise eine Geschichte hat, zeigt sich z.B. bei den Erhebungen der Riots in einzelnen englischen Städten im Sommer 2011. Wenn man sich an die Bilder der rebellischen Jugendlichen erinnert, so fällt es anfänglich schwer, von einer Jugendkultur zu sprechen oder von deren Krise. Die soziologischen Analysen zeigen sehr deutlich, dass es bei den Unruhen all jene waren, die sich von der Gesellschaft nicht nur ausgeschlossen fühlten, sondern wirklich ausgeschlossen waren und sind. Shoppen gilt gemeinhin als eine Jugendkultur – was passiert aber, wenn Jugendliche ganzer Stadtviertel, aber nicht nur sie, sondern ganze Generationen, daran nicht teilhaben können? Wenn sie zusehen müssen, wie das Leben an ihnen vorbeiläuft? Ist ein eingeschlagenes Schaufenster und ein geklautes iPhone dann Diebstahl oder Revolte? Jugendkultur in der Krise? Nicht nur in England, wo seit Thatcher durch Massenentlassungen Arbeiterquartiere mit bis zu 100% Arbeitslosigkeit entstanden sind, wachsen jetzt Jugendliche heran, die nie Eltern erlebt haben, die einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen konnten, die vom System ausgespuckt wurden und mit Sozialhilfe „gerade“ über die Runden kamen. Lebensperspektiven – Sinnhaftigkeit in Schulabschlüssen und Ausbildungen – bekamen diese Kids nicht mit auf den Weg. Rebellion wie in London 2011 ist eher die Ausnahme, die meisten Jugendlichen zeichnet vielmehr Resignation aus – Entfremdung, sich nicht als Teil der Gesellschaft erkennend und fühlend. Diese Prozesse finden auch in der Bundesrepublik Deutschland (Hartz IV), in Österreichs großstädtischen „Hot spots“ statt, und zunehmend in allen „krisengebeutelten“ EU-Ländern. Die Jugendlichen selbst werden von den Verantwortlichen kaum erreicht, ihre Anliegen werden nicht ernst genommen, von der Politik marginalisiert oder für „Goodwill“-Aktionen missbraucht, Protestformen von der Gesellschaft kriminalisiert. Manche Jugendkulturen machen Angst – aber haben sie das nicht schon immer getan? Es ist doch so, dass im Selbstfindungsprozess der Jugendlichen in Peergroups Neues entsteht, das ausprobiert und gelebt wird, die Gruppe gibt Rückhalt auch für Mutiges/ Revolutionäres. Aber gerade wenn die Jugendlichen als Gruppe auftreten, verunsichert das Erwachsene, macht Angst (noch immer). Gemeinhin ist unser Begriff von Jugendkultur mit der Aufbruchskultur 1968 besetzt, sodass es für viele schwer fällt, manche Formen der gegenwärtigen Jugendkultur – tatooing, shopping, modeln etc. … – als solche anzuerkennen, da vordergründig nichts Politisches, Gesellschaftskritisches erkennbar ist. Hier müssen aber, wie eingangs erwähnt, viele Fragen gestellt werden: Waren die Jugendkulturen früher tatsächlich politischer? Was unterscheidet Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse – und was verbindet sie? Wann ist eine Jugendkultur in der Krise oder ist Jugendkultur der kultivierte Umgang mit Krisen? Wie weit bestimmt der Kommerz heutzutage die Jugendkultur oder war das schon immer auch eine Begleiterscheinung? Pop hatten wir doch auch schon, oder? Ja und dann gibt es noch die Jugendkulturen in ethnisch durchmischten Wohnvierteln. Was brauchen dort die Kids, um sich von der jeweiligen Herkunftskultur abgrenzen bzw. in ihr bestehen zu können? Wo sind die Berührungspunkte untereinander? Nicht zuletzt ist zu fragen: Machen die gegenwärtigen Verhältnisse den Jugendlichen Angst? Haben sie Angst vorm Anders-/ Unangepasstsein, Angst vor schlechten Jobchancen, Angst vorm Jobverlust? Wie gehen sie mit diesen berechtigten Ängsten um? Jugendkulturen – Revolution oder Mainstream? Die Artikel dieser schulheft-Nummer können nicht auf all diese Fragen und Probleme Antworten geben, sie machen es sich zur Aufgabe, den Begriff der Jugendkultur zu definieren, aber auch zu entmystifizieren. Sie zeigen beispielhaft auf, wie sich die Jugend immer wieder „Kultur“ generiert, welche Veränderungsprozesse in der Gesellschaft neue Formen der Jugendkultur hervorbringen. Zorica Rakić definiert in ihrem Beitrag „JugendKultur“ die Begriffe „Jugend“ und „Kultur“ und versucht, dem Wesen von Jugendkulturen näherzukommen. Dass erst gesellschaftliche Veränderungen in der zweiten Hälfte des 20. Jh. das Phänomen Jugend ins Blickfeld der Wissenschaften rückte, zeigt Agniezka Czejkowska in ihrem Artikel „Jung genug? Zur folgenreichen Fixierung des Jugendbegriffs“. Sie bietet einen Einblick in die Entwicklung des Jugendbegriffs – eine Genealogie einer Lebensphase. Natalie Waechter richtet ihren Blick auf die „Jugendkultur in der Krise? Eine Betrachtung von Jugendkulturen im Kontext der Arbeitsgesellschaft und sozialer Zugehörigkeiten“. Sie geht der Frage nach der Bedeutung der Krise der Arbeitsgesellschaft und der sozialen Zugehörigkeit nach. Die Jugendwertestudie 2012 gibt Auskunft, was es heißt, jung zu sein in Österreich im 21. Jahrhundert, welche Werte zählen, welchen Vorurteilen die Jugend ausgesetzt ist, was sie belastet und wo sie sich selbst verortet. Philipp Ikrath fasst die Ergebnisse der Studie zusammen: „Jungsein im 21. Jahrhundert – Jugend in Österreich 2012“. Aus mehreren Studien geht hervor, dass sich die Jugend heute weniger für Politik interessiere als noch vor 20 Jahren. Wodurch diese Formen der traditionellen Partizipation abgelöst wurden, beschreibt Rosa Reitsamer: „Jugend und politische Partizipation“. Nach einem doch sehr umfangreichen Theorieteil, der sich mit dem Phänomen Jugend beschäftigt, bringen die Beiträge im zweiten Teil Beispiele, wie und wo sich heute Jugendkultur zeigt und wo sie politisch aktiv wird. Harti Oberkofler beginnt mit einem Glossar, das uns einen guten Einblick in die verschiedenen Szenen und deren Entwicklung gibt. Zorica Rakić beschreibt am Beispiel Rap „Ein mögliches entworfenes Lebens- und Identitätskonzept“ . Bernhard Damisch stellt im Interview mit Michael Rittberger die Aktivitäten seines Teams im „5erHaus“, dem Jugendzentrum für Kinder und Jugendliche des 5. Bezirks, dar und erläutert die Hintergründe seiner Arbeit. Am Beispiel „Bitch – Sexismus im Rap“ diskutiert Zorica Rakić Jugendsprache und Sexismus im Rap. Wie und ob die Krise in den Mitteilungen im öffentlichen Raum sichtbar wird, analysiert Thomas Northoff: „Textuelle Graffiti – Inschriftliches von Jugendlichen in den Krisenjahren ab 2008“. Michael Rittberger diskutiert zum Abschluss den Begriff „Kultur“ und versucht, einem starren, weit verbreiteten Kulturbegriff einen Milieubegriff entgegenzustellen, eine Anregung, „Jugendkulturen“ und deren Entwicklungen von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Barbara Falkinger Redaktion Barbara Falkinger AutorInnen Agnieszka Czejkowska, Dr.in, Leiterin des Instituts für Pädagogische Professionalisierung an der Karl-Franzens-Universität Graz. agnieszka.czejkowska@uni-graz.at Bernhard Damisch, Leiter des interkulturellen Jugend- und Stadtteilzentrums „5er-Haus“ in Wien Margareten. b.damisch@5erhaus.at Barbara Falkinger, Lehrerin in der Lerngemeinschaft 15, einem Schulversuch für eine gemeinsame Schule von 6–14, Mediatorin und Konfliktmoderatorin im außerschulischen Jugendbereich. barbara@falkinger.net Philipp Ikrath, Mag., Studium der Theaterwissenschaften und Germanistik, Fachhochschule für Marketing und Sale. Senior Researcher am Institut für Jugendkultur und seit 2005 Studienleiter der tfactory Hamburg. pikrath@jugendkultur.at Thomas Northoff, Volkskundler (Schwerpunkt Text-Graffiti) und Schriftsteller in Wien. Seit 1983 Aufbau des Österreichischen GraffitiArchivs für Literatur, Kunst und Forschung. Stellte Graffiti-Forschung in den Symposien „Die Sprache an den Wänden“ (1992, 1993, 1998) als Forschungszweig vor. Zahlreiche Publikationen. thomas.northoff@aon.at Harti Oberkofler, Koordinator für den Bereich Jugendkultur bei KUS – Netzwerk für Bildung, Soziales, Sport und Kultur, Wien15, Projektkoordination für das KUS-Soundprojekt.h.oberkofler@kusonline.at Zorica Rakić, Mag. Dr. Dr.in, Studien und Ausbildungen: Staatliches Konservatorium P.I.Tschaikowski in Kiev, Ukraine-Musikpädagogik und Konzertmeisterin für Akkordeon; IFP-Jugendleiterschule und Aufbaulehrgang Jugendarbeit; Universität Wien, Musikwissenschaft und Fachkombination Pädagogik und Soziologie, Doktoratstudium für Musikwissenschaft und Doktoratstudium für Soziologie. Seit 22 Jahren in unterschiedlichen Bereichen und Vereinen der Kinder- und Jugendbetreuung in Wien tätig. dr.rakicz@gmail.com Rosa Reitsamer, Dr.in, Soziologin, Assistentin am Institut für Musiksoziologie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Michael Rittberger, Dr., Studium der Philosophie und Erziehungswissenschaft, Sonderschullehrer am SPZ11, Wien. rittbergerm@gmail.com Natalia Waechter, Dr.in, Soziologin, Politikwissenschaftlerin und Jugendforscherin, wissenschaftliche Projektkoordinatorin am Institut für Höhere Studien in Wien. Lektorin am Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien, am Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Innsbruck sowie am Institute for European Studies (Wien/Chicago). Seit 2010 Europäische Präsidentin der Jugendsoziologie der International Sociological Association. Forschungsschwerpunkte: Jugendforschung (Jugend und Politik, Jugendkultur, Cyberyouth), Gender Studies und Migrationssoziologie. Studienverlag: Schulheft 147Klappentext

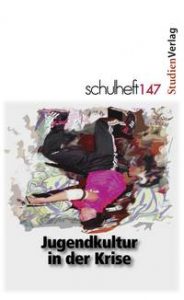 Was es heißt, jung zu sein im 21. Jahrhundert, versucht dieses schulheft zu beschreiben und zu analysieren. Der Begriff „Jugendkultur“ wird definiert und entmystifiziert. Aufgezeigt wird, wie Jugend immer wieder „Kultur“ generiert, denn Veränderungen in der Gesellschaft wirken sich auf die Ausdrucksformen der jugendlichen Lebenswelten aus. Der Frage nach der Bedeutung der Krise der Arbeitsgesellschaft und der sozialen Zugehörigkeit und deren Auswirkungen auf das Leben der Jugendlichen wird nachgegangen und untersucht, was junge Menschen belastet und wie sie sich selber verorten.
Was es heißt, jung zu sein im 21. Jahrhundert, versucht dieses schulheft zu beschreiben und zu analysieren. Der Begriff „Jugendkultur“ wird definiert und entmystifiziert. Aufgezeigt wird, wie Jugend immer wieder „Kultur“ generiert, denn Veränderungen in der Gesellschaft wirken sich auf die Ausdrucksformen der jugendlichen Lebenswelten aus. Der Frage nach der Bedeutung der Krise der Arbeitsgesellschaft und der sozialen Zugehörigkeit und deren Auswirkungen auf das Leben der Jugendlichen wird nachgegangen und untersucht, was junge Menschen belastet und wie sie sich selber verorten.Inhalt
Jung genug? Zur folgenreichen Fixierung des Jugendbegriffs
JugendKultur
Jugendkultur in der Krise? Eine Betrachtung von Jugendkulturen im Kontext der Arbeitsgesellschaft und sozialer Zugehörigkeiten
Jungsein im 21. Jahrhundert – Jugend in Österreich 2012
Jugend und politische Partizipation
Jugendkultur – Versuch eines Glossars
Jugendkultur in der Krise. Ein mögliches entworfenes Lebens- und Identitätskonzept am Beispiel Rap
Das 5erHaus. Ein Gespräch mit Bernhard Damisch, dem Leiter des Jugendzentrums in Margareten
„Bitch“ – Sexismus im Rap
Textuelle Graffiti – Inschriftliches von Jugendlichen in den Krisenjahren ab 2008
Kultur? (Ein Abschluss)Vorwort
AutorInnen
Zorica Rakić
Michael RittbergerBestellen