Kritische Soziale Arbeit
Blitzlichter und Positionen
 Klappentext
Klappentext
In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Widersprüche und damit einhergehend wachsender Problemlagen auch im Bildungssystem wird der Ruf nach Sozialer Arbeit an den Schulen immer lauter – Anlass sich mit den Grundlagen Möglichkeitsräumen Zugängen und Grenzen kritischer Sozialer Arbeit näher auseinanderzusetzen.
Existierende Ansätze und Möglichkeitsräume für kritische Soziale Arbeit sowie Blitzlichter auf theoretische Zugänge und politische Positionen werden exemplarisch aufgezeigt und damit gleichzeitig die Profession Soziale Arbeit von der schulischen Supporterwartung entbunden.
Inhalt
Editorial
Claudia Krieglsteiner
Sozialisierung der Ökonomie statt Ökonomisierung der Sozialarbeit
Aurelia Sagmeister
Auf der Suche nach dem Politischen Mandat
Eine intergenerationale Untersuchung des beruflichen Selbstverständnisses von Sozialarbeitenden
Hubert Höllmüller, Barbara Zach
Burgenland: Soziales und Pflege „wieder in die Hände eines intelligent agierenden Staates“ legen?
Antje Haussen Lewis
Meso-Aktivismus: Überlebensstrategien für kritische Sozialarbeiter:innen in nichtkritischen Organisationen
Monika Barz
Geschlecht als zentrale Kategorie Sozialer Arbeit
Kritische Analyse der postfaktischen (Um)Definition von Geschlecht in der deutschen Gesetzgebung
Cornelia Renolder
Einübungen in Demokratie. Aus dem Alltag einer Organisation, die erwachsene Menschen mit Behinderungen unterstützt
Hannes Schlosser
Zur Geschichte des Politischen Mandats in der Sozialen Arbeit aus einer Tiroler Perspektive
Veronika Reidinger, Arno Pilgram
Das politische Mandat in der NEUSTART-Straffälligenhilfe im Wandel
Florian Neuburg
Extrem schwierig? – (Jugend)sozialarbeit und Extremismusprävention
Autor:innen dieser Ausgabe
Editorial
In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Widersprüche und damit einhergehend wachsender Problemlagen, auch im Bildungssystem, wird der Ruf nach Sozialer Arbeit an den Schulen immer lauter – Anlass, sich mit den Grundlagen, Möglichkeitsräumen, Zugängen und Grenzen kritischer Sozialer Arbeit näher auseinander zu setzen.
Das schulheft beschäftigte sich zwar immer wieder mit Fragestellungen aus dem Kontext der Sozialen Arbeit. Eine Ausgabe explizit zu diesem Thema wurde jedoch zuletzt 2008 herausgegeben, auch damals vor dem Hintergrund, dass sich Lehrer:innen mit teils unerfüllbaren Erziehungsaufgaben konfrontiert sahen und von der Sozialen Arbeit Hilfe erhofften.
Soziale Arbeit ist auch heute noch nicht an allen Schulen implementiert, und wo doch, fehlt es oft an zeitlichen Ressourcen bzw. Handlungsmöglichkeiten. Sie muss oftmals um Anerkennung gegenüber den anderen im Schulsystem bereits verankerten Professionen ringen und sich im Kampf um die Definitions- und Interventionsmacht im Konkurrenzbetrieb Schule behaupten. Gleichzeitig ist Schulsozialarbeit unserem Eindruck nach im Feld Sozialer Arbeit nur brüchig verankert und es gibt unzureichende Vernetzungen mit anderen Sozialarbeitsfeldern, damit einhergehend nur eingeschränkte Reflexionsmöglichkeiten.
In erster Linie konzentriert sich Schulsozialarbeit auf die Arbeit mit dem einzelnen Kind oder Jugendlichen. Schulische und soziale Rahmenbedingungen mögen von Sozialarbeitenden als problemgenerierende Faktoren erkannt werden, sind jedoch nicht Gegenstand ihrer Arbeit. Aufsuchende Soziale Arbeit, direkte Unterstützung in den Familien und Herkunftsmilieus der Kinder ist für Schulsozialarbeit nicht vorgesehen und muss ausgelagert werden. Dazu findet sich zwar ein Dschungel an Angeboten: Schulkooperationsteams, Kinderschutzzentren, Sozialassistenzen, Diagnostikzentren, Erziehungshilfen, Therapieangebote, Familienzentren, Gewaltschutzzentren, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Angehörigenunterstützung, Selbsthilfegruppen, Familienberatung, Kriseninterventionsstellen etc. Aber auch in diesen Feldern zählen mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen zu den Hauptproblemen – etliche dieser Einrichtungen arbeiten prekär, rangeln jedes Jahr erneut um Förderungen und/oder leben von Freiwilligenarbeit mit allen damit verbundenen Problemlagen (große Fluktuation, eingeschränkte Handlungskompetenz, fragliche Professionalität, etc.).
Angesichts ihrer limitierten Möglichkeiten im Kontext Schule erscheint die schulische Hoffnung auf Support durch Soziale Arbeit unrealistisch. Sie kann jedenfalls die grundsätzlichen Fragen des Schulsystems nicht lösen: Warum passen so viele Kinder „nicht dazu“, warum „fallen so viele Kinder raus“, warum produziert das System so viele Abweichungen? Soziale Arbeit wird im Regelfall erst tätig, wo Abweichung als solche bezeichnet (bzw. gegebenenfalls durch Diagnostik erst produziert) wird – und zwar in erster Linie Abweichung in ressourcenschwachen Milieus (wohingegen Abweichungen in ressourcenstärkeren Milieus eher den Weg in private Therapien, Coachings, etc. finden).
Die Medien sind voll mit Berichten über Gewalt an Schulen, es kursieren erschreckende Statistiken zu (sexualisierter) Gewalt, Horrormeldungen über Extremismus und Radikalisierung. Dem begegnet man mit absurden Finanzierungsideen (z.B. „100 Schulen – 1000 Chancen“, das jegliche Nachhaltigkeit vermissen lässt); statt Systemwandel anzugehen werden Projektförderungen als Pflaster verteilt. Eine Ressourcenverteilung entlang eines seriösen Chancenindex (Mittelzuteilung an die Bildungseinrichtungen entlang sozioökonomischer Herausforderungen) ist bis heute nicht in Sicht. Politisches Engagement hält sich bei Lehrer:innen traditionell in Grenzen (was sich nicht zuletzt in der Beschaffenheit ihrer Interessensverbände und Berufsvereinigungen niederschlägt), womit die Tür zu Ermächtigung und Selbstermächtigung, zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Einforderung gesellschaftlicher Teilhabe schulpädagogisch weitgehend verschlossen bleibt.
Erziehungsberechtigte in den Mittelschichten haben Angst, ihr Kind in der Sekundarstufe dem sozialen Milieu einer Mittelschule auszusetzen; sozioökonomische Durchmischung, insbesondere in der Sekundarstufe, findet an den Schulen in den Ballungsgebieten quasi nicht statt. Eine Verminderung der Ausgrenzung von Jugendlichen mittels der Auflösung des Parallelsystems im Sekundarstufenbereich scheinen politisch Verantwortliche nicht einmal mehr am Schirm zu haben. Aufgehängt wird die sozioökonomische Trennung an Sprachkompetenzen und Begabungskonstrukten. Der große Jammer über die vielen Seiteneinsteiger:innen, denen es an Deutschkenntnissen und schulischer Vorbildung mangeln würde, lässt aus dem Blick geraten, dass es sich dabei vorwiegend um Kinder und Jugendliche aus wirklich armen und marginalisierten Milieus handelt, deren geringste Herausforderung es ist, dass sie eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen oder das österreichische Schulsystem nicht kennen. Die Schulen können diese Probleme schulentwicklerisch nicht lösen, womit wir wieder bei der „Heilserwartung an die Supportsysteme“ wären. Durch den fortgeschrittenen Kapitalismus als gesellschaftliche Krankheit mit all seinen sich ständig verschärfenden Klassen- und anderen Widersprüchen krankt jedoch auch das Schulsystem – dieses Problem kann Soziale Arbeit nicht heilen.
Wir erleben seit Jahrzehnten zwei ineinander verwobene Tendenzen, nämlich den Abbau sozialstaatlicher Leistungen und Unterstützungsangebote durch Soziale Arbeit einerseits und den gleichzeitigen Ausbau sozialer Kontrollen und Sanktionen andererseits. Die Selbstoptimierungsansprüche an alle Personen, auch an jene, die als Klient:innen Sozialer Arbeit in Frage kommen, werden immer größer. Verantwortung wird damit an die Klient:innen ausgelagert; bei wem eine Abweichung durch soziale Kontrolle registriert wird, wird – auch mit Hilfe Sozialer Arbeit – zur Selbstverbesserung aufgefordert und bei Nichterfüllung sanktioniert. Zunehmend weniger geht es dabei um die Bedürfnisse der Klient:innen oder um die Erweiterung von deren Handlungsmöglichkeiten, als um das Zuteilen von Rechten und gegebenenfalls Ressourcen durch bürokratische Prozesse.
Soziale Arbeit hieß immer schon auch, den „selbstverschuldeten und mitunter tragischen Ausschluss“ reparieren zu helfen. Gleichzeitig gab es für Sozialarbeitende aber auch immer die Möglichkeit, es anders anzugehen, Spielräume zu nutzen, nicht nur Anpassung abzuverlangen, sondern auch die Durchlässe für Einschluss und Teilhabe zu verbreitern bzw. auf kollektive Weise diese gesellschaftliche Teilhabe gemeinsam mit den Klient:innen einzufordern und an der Veränderung der exkludierenden Strukturen zu arbeiten.
Soziale Arbeit, die sich diesem Ziel verschreibt, wird als „kritische Soziale Arbeit“ bezeichnet und umfasst im deutschen Sprachraum drei Strömungen: die Kritische Soziale Arbeit im Anschluss an Marx/Engels und die Kritische Theorie der Frankfurter Schule; die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch sowie die „systemistische Theorie“ nach Silvia Staub-Bernasconi, auch als „Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“ bekannt. Auch wenn es ewige Debatten um den Begriff der „Kritik“ gibt, sich die genannten Strömungen mitunter gegenseitig „nicht grün“ sind, so ist doch „die Bezeichnung kritische Soziale Arbeit nicht beliebig. Ohne ein emanzipatorisches Interesse, das dem historisch-fundamentalen Sachverhalt einer als illegitim erfahrenen Herrschaft entspringt, kann es weder eine Kritik an der Gesellschaft noch eine kritische Soziale Arbeit geben.“[1] Gesellschaftskritik verlangt nach Theorie, die in den Sozialarbeitswissenschaften selbst wie in ihren Bezugswissenschaften geleistet wird. Soziale Arbeit speist sich neben professionseigenen Quellen wesentlich aus den Wissensbeständen insbesondere der Sozialwissenschaften (Soziologie, Ökonomie, Sozialanthropologie oder Politikwissenschaft), aber auch der Rechtswissenschaften oder der Psychologie. Das gilt nicht nur für die Kritische Soziale Arbeit mit ihrem marxistischen Background: Systemische Ansätze wären ohne Niklas Luhmann nicht denkbar, die Lebensweltorientierung nicht ohne die phänomenologische Soziologie von Alfred Schütz (u.a.) und die Theorie der deliberativen Demokratie nach Jürgen Habermas, die feministische Soziale Arbeit nicht ohne Bezug auf Feminismen/Gender Studies etc. Soziale Arbeit ist also ohne kritische Gesellschaftstheorien nicht denkbar (und vice versa). Die Aufgabe, alle Analyseebenen von der Mikro- bis zur Makroebene kritisch im Blick zu behalten, ihre gegenseitige Interdependenz immer wieder neu zu verstehen, Theorie und Praxis in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen, die Verwobenheit der eigenen Profession ins Herrschaftssystem zu reflektieren etc. sind einige der Herausforderungen dieser schwierigen, aber auch spannenden Profession. Nachdem Soziale Arbeit von uns als kritische Handlungswissenschaft verstanden wird, die eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis auszeichnet, haben wir auf die im schulheft tendenziell übliche Trennung in theoretische Grundlagen und Handlungsfelder verzichtet.
Die Spielräume für komplex verstandene Soziale Arbeit werden enger, womit kritische Sozialarbeiter:innen immer mehr in die Überforderung geraten, ihren eigenen Ansprüchen bzw. denjenigen der Profession an ein reflexives Herangehen nicht gerecht werden zu können. Was oft in „Handwerkelei“ und der Übernahme von Alltagswissen endet, lässt sich dann mit dem Satz „das herrschende Wissen ist das Wissen der Herrschenden“ beschreiben.
Zusammen mit suboptimalen monetären und arbeitszeitlichen Rahmenbedingungen, die nicht zufällig einen traditionell weiblichen Beruf betreffen, sind Berufswechsel, Burnout, Aufgabe der eigenen Ansprüche oder Abgleiten in den Zynismus häufig zu beobachtende Folgewirkungen. Diese Überforderung zeigte sich übrigens auch im Produktionsprozess dieses Heftes; zunächst in der Schwierigkeit, Autor:innen zu finden oder die Redaktion arbeitsfähig zu halten, da kritische Sozialarbeitende sich tendenziell im Zustand völliger Arbeitsüberlastung befinden. Zu Überforderung und Überarbeitung kommt als eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen auch die Angst, sich in der Sozialarbeitscommunity zu exponieren und mit der eigenen Sichtweise „gecancelt“ zu werden. Die Diskurskultur hat sich seit dem letzten schulheft zu Sozialer Arbeit von 2008 merkbar verschärft, Zensur und Selbstzensur haben auch in die Soziale Arbeit Eingang gefunden, die oft von den Sozialarbeitenden nicht mehr als sicheres Arbeitsumfeld empfunden wird. Bereits mit jemand gemeinsam zu publizieren, der/die nicht der gleichen Diskurslinie angehört, wird mitunter zu einem Wagnis.
Wir versuchen im vorliegenden Heft, existierende Ansätze und Möglichkeitsräume für kritische Soziale Arbeit exemplarisch aufzuzeigen, und damit gleichzeitig die Profession Soziale Arbeit von der schulischen Supporterwartung zu befreien. Besonders freuen wir uns, in diesem Heft Autor:innen aus verschiedenen Zugängen zu Sozialer Arbeit zusammengeführt zu haben.
Ökonomisierung und betriebswirtschaftliches Herangehen feiern ihren Siegeszug auch in der Sozialen Arbeit. Dieser Entwicklung geht Claudia Krieglsteiner in ihrem Beitrag nach. In der Arbeit von Menschen mit Menschen stecken jedoch immer auch widerspenstige, nicht normierbare Anteile. An diesem Widerspruch anzuknüpfen und die Möglichkeiten für emanzipatorische Soziale Arbeit auszuloten, hat sich der Beitrag „Sozialisierung der Ökonomie statt Ökonomisierung der Sozialarbeit“ vorgenommen.
Aus der „Internationalen Definition Sozialer Arbeit“ und dem Konzept des Tripelmandats lässt sich die Rolle der Profession als politische Akteurin klar ableiten; in der praktischen Umsetzung ist sie in dieser Deutlichkeit jedoch nicht immer gegeben. Aurelia Sagmeister stellt in ihrem Beitrag Erkenntnisse zum professionellen Selbstverständnis Sozialarbeitender verschiedener Generationen in Österreich vor. Sie widmet sich der Frage, ob sich das politische Selbstverständnis Sozialarbeitender und die Rolle Sozialer Arbeit in Politik und Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte verändert haben. Der Beitrag endet mit Vorschlägen für die sozialarbeiterische Praxis und Ausbildung in Österreich.
Eine bemerkenswerte Entwicklung im Burgenland untersuchen Hubert Höllmüller und Barbara Zach: Entgegen dem Trend neoliberaler Staatlichkeit zum Outsourcing von Angeboten und Dienstleistungen geht die SPÖ-geführte Landesregierung dort den umgekehrten Weg des Insourcings, auch im Bereich Sozialer Arbeit und Pflege. Eine in Hinblick auf Demokratiepolitik und das politische Mandat ambivalente Entwicklung.
Antje Haussen Lewis begibt sich auf Basis eines interaktionistischen Herangehens, das in der englischsprachigen kritischen Sozialarbeitswissenschaft verbreiteter zu sein scheint als in der deutschsprachigen, auf die Suche nach Wissen zu sozialarbeiterischem Handeln innerhalb von Organisationen. Ihr Anliegen, die internationale Literatur zu kennen und zu rezipieren, fördert zahlreiche noch wenig diskutierte Ansätze für Widerstandspraxen und -strategien zu Tage.
Monika Barz setzt sich kritisch mit dem am 1. November 2024 in Deutschland in Kraft getretenen Selbstbestimmungsgesetz auseinander, das die Kategorie des biologischen Geschlechts durch das Konzept „Geschlecht als subjektives Gefühl“ ersetzt hat. Die Autorin macht deutlich, welche negativen Konsequenzen damit für die Soziale Arbeit mit Frauen und Mädchen, aber auch für Frauenrechte und für die Demokratie einhergehen können.
Anhand eines Praxisbeispiels zeigt Cornelia Renolder, wie emanzipatorische Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen von der Institution her implementiert und unterstützt werden kann. Die von ihr beschriebenen Einübungen in Demokratie, die im vorliegenden Beispiel institutionell unterstützt werden, führen zu beeindruckenden Prozessen der Selbstermächtigung.
In den 1970er-Jahren wuchs die Zahl der Sozialarbeiter:innen, die ein politisches Mandat der Sozialen Arbeit als Teil ihres Selbstverständnisses sahen. Hannes Schlosser erläutert anhand seiner Rolle bei der Aufklärung eines Skandals in einer Justizanstalt in Tirol, was Sozialarbeit damals unter dem politischen Mandat verstanden hat und woran er unter seither geänderten gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen und Bedingungen festhält.
Veronika Reidinger und Arno Pilgram stellen die Frage, ob die „abolitionistische Selbstmandatierung“ der Straffälligenhilfe durch die Übernahme von zusätzlichen Arbeitsaufgaben bzw. die Arbeitsverdichtung ohne zusätzliche Ressourcen, durch ein Zusammenwerfen von Sozialer Arbeit mit therapeutischen Aufgaben und durch eine grundsätzliche Änderung des Herangehens am Verschwinden ist. Ging es in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende um den Kampf für eine gefängnisfreie Gesellschaft, liegt mit dem „Ausgleichsparadigma“ der Fokus nun auf der Vermeidung und Begrenzung von Schadensfällen, deren sozialem Ausgleich, bzw. dem (sanften) Zwang zu Lernprozessen von Straffälligen, wohingegen das Ziel einer Gesellschaft, die keine Gefängnisse braucht, aus dem Blick gerät.
Schließlich beschäftigt sich Florian Neuburg in seinem Beitrag mit Jugendsozialarbeit und Extremismusprävention, wobei es ihm um ein tiefergehendes Verständnis der Entstehungs- und Bewegungsdynamik politischer (Jugend)bewegungen geht. Mit dem Blick auf Präventionsarbeit zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hinterfragt er Narrative zu Extremismus und gesellschaftlicher Mitte und erläutert die Unerlässlichkeit eines weiten Blicks auf gesellschaftlichen Kontext, kollektive Sozialisationsinstanzen und Resilienz im biografischen Kontext. Exemplarisch beschreibt er ein Projekt, in dem Biografiearbeit als Methode in der Radikalisierungsprävention zum Einsatz kam.
Wie immer möchten wir betonen, dass die Position eine:r Autor:in nicht derjenigen der Redaktion entsprechen muss.
[1] Stender, W. & Kröger, D. (Hrsg.) (2013): Soziale Arbeit als kritische Handlungswissenschaft. Beiträge zur (Re-)Politisierung Sozialer Arbeit (Bd. 21). Hannover: Blumhardt, 9
Autor:innen dieser Ausgabe
Herausgeber:innen
Barbara Zach
Antje Haussen Lewis
Claudia Krieglsteiner
Henrike Kovacic
Monika Barz, Jahrgang 1953. Von 1993-2016 Professorin an der Evangelischen Hochschule Reutlingen und Ludwigsburg in Lehre und Forschung zu Frauen- und Geschlechterfragen tätig. Prorektorin, Promotionsbeauftragte und Entwicklung Studiengang „Internationale Soziale Arbeit“. Seit den 1970er Jahren frauen- und lesbenpolitisch aktiv, Mitinitiatorin eines Frauenhauses und einer Notrufgruppe für vergewaltigte Frauen, einer kirchlichen Lesbenbewegung und eines LSBTTIQ-Netzwerks. Sie ist Trägerin der Goldenen Ehrennadel des Paritätischen Baden-Württemberg und des Bundesverdienstkreuzes.
Hubert Höllmüller, Professur für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendalter, Lehrgangsleitung „Akademische Jugendsozialarbeit“, „Erlebnispädagogik“ und „Familienrat“ an der Fachhochschule Kärnten, Lehraufträge an der TH Köln und der FH Potsdam, Forschungen zur Kinder- und Jugendhilfe und zum Westsaharakonflikt.
Henrike Kovacic, geb. 1976, politische Aktivistin, Freizeitpädagogin, Gewerkschafterin, Betriebsrätin, Frauenbeauftragte der IG-Social.
Claudia Krieglsteiner, 1960 in Tirol geboren. Sozialakademie in Innsbruck, anschließend bis 1985 Bewährungshelferin. Umzug nach Wien und in verschiedenen Funktionen bei der KPÖ beschäftigt. 2003 bis 2005 Masterstudium „Soziale Arbeit und Sozialmanagement“. Anschließend bis zu ihrer Pensionierung 2021 als Sozialarbeiterin bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe tätig.
Antje Haussen Lewis, geb. 1964. Aktivistin mit bescheidenem Erfolg, Sozialarbeiterin und Ausländerin seit 1988 in Wien, davor England und USA. Praxis vorwiegend in der Wohnungslosenhilfe. Erfahrung in der Hochschullehre zu den Themen: Methoden, Beratung, Theorien Sozialer Arbeit. Besondere Interessen: Kritische Praxis, Koproduktives Dokumentieren und Lebendige Interkulturalität in der Profession.
Florian Neuburg, geb. 1975 in Wien. Soziologe/Politikwissenschafter und langjähriger Jugendarbeiter. Forscht und lehrt im Bereich der Offenen Jugendarbeit. Vorstandsmitglied im Wiener Verein turn (Onlinestreetwork und Präventionsarbeit im Bereich jihadistischer Jugendszenen). Sozialarbeiterische Tätigkeit beim Flüchtlingsdienst der Diakonie.
Arno Pilgram, geb. 1946. Studium der Psychologie, Habilitation an der Universität Frankfurt/Main und der Universität Wien, seit dessen Gründung 1973 Mitarbeiter am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien, zeitweise als Institutsleiter. Seit 1981 in Funktionen im Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit / Neustart.
Veronika Reidinger, geb. 1983. Studium der Soziologie und Sozialen Arbeit, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung und am Vienna Centre for Societal Security. Lehraufträge am Department Soziale Arbeit (FH St. Pölten). Ehrenamtlich in der Bewährungshilfe aktiv.
Cornelia Renolder, geb. 1956 in Stralsund (damals DDR). Studium Germanistik/Anglistik in Rostock, Lehrerin in Neubrandenburg, als Pädagogin in Tagesstätten/Internat für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Neubrandenburg, Berlin, Wien, Bern. Von 1996-2021 bei BALANCE Leben ohne Barrieren GmbH in Wien und NÖ. Seit 2022 Pensionistin.
Aurelia Sagmeister, arbeitet in Wien im Jugendbereich. Sie hat 2021-2023 den Erasmus Mundus Master „Advanced Developement in Social Work“ absolviert. Davor hat sie in Wien Geschichte und Soziale Arbeit studiert und war als Sozialarbeiterin tätig. Ihrer Meinung nach ist Soziale Arbeit immer politisch.
Hannes Schlosser, geb. 1951 in Wien. Lebt seit 1975 in Innsbruck, wo er bis 1983 als hauptamtlicher Bewährungshelfer tätig war. Anschließend bis 1991 Landessekretär der KPÖ Tirol. Seit 1991 Journalist, Sachbuchautor und Fotograf, u.a. Tirol-Korrespondent „Der Standard“ (1996–2008), Publikationen für den Österreichischen Alpenverein (z.B. Buchreihe Alpingeschichte von Bergsteigerdörfern). Seit 2007 Lektor für Öffentlichkeitsarbeit am MCI, FH Soziale Arbeit in Innsbruck. Jüngste Buchpublikation (gemeinsam mit Andrea Sommerauer): „Gründerzeiten – Soziale Angebote für Jugendliche in Innsbruck 1970–1990“, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2020.
Barbara Zach, geb. 1966, Politikwissenschafterin. Sozialarbeiterin mit 20jähriger Praxis in den Arbeitsfeldern Flucht/Migration, psychosozialer Dienst, Frauen- und Mädchenberatung. Psychosoziale und personzentrierte Beratung, Projektleitung, Erfahrung in Gemeinwesenarbeit. Mehrjährige Praxis als Erwachsenenbildnerin. Freiberuflich Lehrende an FH und Universität.
Bestellen
Studienverlag: Schulheft 196
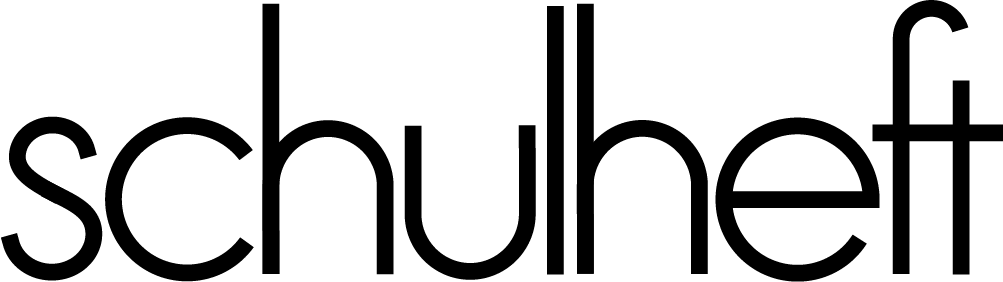
 Klappentext
Klappentext