Eltern und Schule
Die gegenseitige Enttäuschung?
 Klappentext
Klappentext
Eltern geraten zunehmend in das Spannungsfeld schulischer und gesellschaftlicher Anforderungen. Das Heft beleuchtet kritisch das komplexe Verhältnis zwischen Eltern und Schule, geprägt von Machtasymmetrien und struktureller Ungleichheit. Es zeigt, wie Bildungsstrukturen Diskriminierung und Machtverhältnisse verstärken, insbesondere für armutsgefährdete, behinderte oder migrantische Eltern. Autor:innen fragen nach demokratischer Beteiligung und solidarischem Handeln. Die Beiträge verstehen sich als Einladung, über Eltern und Schule neu nachzudenken, Raum für tiefergehende Analysen zu öffnen und nicht in schnell getätigten gegenseitigen Schuldzuweisungen die Handlungsfähigkeit zu verlieren.
Inhalt
Editorial
Luisa Genovese & Oxana Ivanova-Chessex
(Un-)Mögliche Allyships? Familie, Schule und kritische Pädagogik
Marem Baibulatova
Schulwahl, Segregation und Bildungsungleichheit
Marlies Adler, Felix Strouhal
„… denn hier kann man glückliche Kinder sehen!“
Über die Absichten und Funktionsweisen von Selbstpräsentationsvideos einzelner Schulen
Rahel More
Fähigkeitserwartungen zwischen Eltern und Schule
Wie Ableismus Mütter und Väter mit Lernschwierigkeiten verAndert
Sonja Tollinger
Enttäuscht sein und behindert werden
Elternschaft im Kontext von Behinderung im österreichischen Bildungssystem
Angie Weikmann
Gedanken einer schulpolitisch engagierten Mutter
Barbara Trautendorfer
„Durchs Reden kommen d’Leut zam!“
Autorin ist Frauenrechtsaktivistin bei FEM.A
Nie genug?
Alleinerzieher:innen auf dem Prüfstand im Bildungssystem
Brief an die Lehrer:innen meines Kindes
Rosalinda
Unsicherheiten einer Quereinsteigerin in der Elternarbeit
Ellen Kollender
Diskriminierungskritische Schulentwicklung durch Kooperationen mit Eltern?
Überlegungen im Anschluss an Strategien des Community Organizing
Danijela Radić
Freizeitpädagogik und Schulpartnerschaft
Maresi Strouhal
Vom Schulzwangerlass zur Schulgemeinschaft
Ines Garnitschnig, Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien
Von den Handlungsgründen anderer und dem Schaffen neuer Räume
Gelingensfaktoren von Bildungsparter:innenschaft – Wiener Orientierungsklassen, „Familie in Schule“ und darüber hinaus
Judith Goetz
Antifeministische Angriffe auf sexuelle Bildung
Zur Rolle von Eltern in der Berichterstattung über Kinderbuchlesungen von Dragqueens
Karl Heinz Gruber (1942–2025)
Autor:innen dieser Ausgabe
Editorial
Eltern[1] stehen hoch im (Dis)kurs: als überengagiert oder desinteressiert, überlastet oder zu fordernd, wohlgesonnen oder nicht kooperativ, archaisch oder modern usw. bezeichnet, werden sie zu einem Austragungsort aktueller Bildungsdebatten im Krisenkapitalismus. Sie sollen beraten, gebildet, erzogen oder unterstützt werden und dafür werden Angebote aus dem Boden gestampft. Sie sollen mehr arbeiten und sich besser um ihre Kinder kümmern. Sie sollen sich mehr in die Institutionen einbringen, aber nicht überall mitreden wollen. Bei all diesen An- und Widersprüchen wird zugleich die Umsetzung von Kinderrechten, wie sie aktuell (noch) im Rahmen der „Familienzusammenführung“ passiert, medial als die Ursache für einen bevorstehenden Schulkollaps skandalisiert. Zugleich differenziert Politik stark zwischen verschiedenen Elterngruppen. Einerseits werden insbesondere nicht-wahlberechtigten Eltern Sanktionen als „Integrationsmaßnahme“ angedroht, sollten sie nicht ihren Pflichten gegenüber der Schule erfüllen (Regierungsprogramm 2025, 100). Anderseits wurden familienpolitisch in den letzten Jahren gutverdienende Familien steuerlich entlastet, während eine Kindergrundsicherung weiter auf sich warten lässt und viele Familien in Österreich stark armutsgefährdet sind.
In diesem schulheft wird die Frage gestellt, warum die gegenwärtige Adressierung und Einbeziehung von Eltern häufig Unzufriedenheiten hervorruft und nicht unbedingt mit einer größeren Partizipation aller Eltern oder der Demokratisierung von Schule einhergeht. Ob im Konzept der Schulpartnerschaft zwangsläufig Machtstrukturen reproduziert werden und der Einfluss von als „normal“ geltenden Familien erweitert wird, während es jene ausschließt, die bereits Diskriminierung erfahren? Kann die Zusammenarbeit von Eltern und Schule eine Möglichkeit sein, um auch marginalisierten Eltern Gehör zu verschaffen?
Die Autor:innen zeichnen mit ihren Beiträgen eine – nicht vollständige – Landkarte der verschiedenen Zugänge zu dem Zusammenwirken von Eltern, Schule und Gesellschaft. Diese Zugänge unterscheiden sich je nach Person und Akteur:innengruppe stark darin, wo genauer hingesehen wird und was (un)bewusst ausgeblendet wird. Auch in der Erklärung, Interpretation und den Ansätzen zur Bekämpfung verschiedener Missstände sind klare Unterschiede erkennbar.
Thematisiert werden beispielsweise die Funktionsweisen der Benachteiligungen von armutsbetroffenen Familien sowie Eltern mit Migrationsgeschichte. Es werden Faktoren und Barrieren untersucht, die die „Schulentscheidungen“, insbesondere an den Nahtstellen vor und nach der Volksschule, beeinflussen. Es werden jene systemischen Krisen analysiert, die hinter den Zuspitzungen liegen und es wird gezeigt, wie sie in der Zusammenarbeit von Pädagog:innen und Eltern virulent werden. Das Verhältnis zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen im Kontext von BeHinderung wird kritisch beleuchtet.
Dass heteronormative Familienbilder und vergeschlechtlichte Arbeitsteilungen weiter wirksam sind, zeigt nicht zuletzt die Zusammensetzung der Beiträge und Redaktion dieses Heftes, die beteiligten Personen werden fast ausnahmslos weiblich gelesen. Elternarbeit – und anscheinend auch das Schreiben darüber – scheint vorwiegend Sache von Frauen* zu sein. Hätten wir also doch „Mütter“ im Titel schreiben sollen, um das nicht unsichtbar zu machen? Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass Elternschaft als Care-Arbeit Aufgabe aller Geschlechter sein sollte, ebenso wie sie nicht der patriarchalen Kleinfamilie überantwortet und im Interesse des „eigenen“ Kindes verfolgt werden, sondern gesellschaftliche Verantwortung und im Interesse aller Kinder sein sollte? Dass dem nicht so ist, darin liegt eine der Enttäuschungen, die dieses Heft – indirekt – thematisiert.
Der Beitrag von Luisa Genovese und Oxana Ivanova-Chessex führt in das besondere Konzept der hierarchischen „Partnerschaft“ zwischen Eltern und Schule ein. Die Autor:innen greifen die strukturell bedingten Dilemmata und Machtverhältnisse auf, in denen die „erschöpften Eltern“ und die herrschaftsstabilisierende Schule zusammenarbeiten. Auf Basis der kritischen Pädagogik von bell hooks entwickeln sie einen Gegenentwurf zu systemerhaltenden Strategien, der auf das Konzept von allyship fokussiert: Das Verhältnis von Familie und Schule könnte in diesem Sinne als Praxis der Solidarisierung und des Verbündet-Werdens gestaltet werden, um die grundlegenden Strukturen der Schule zu verändern.
Wie die „flexible Schulwahl“ mit Segregation und Bildungsungleichheit zusammenhängt, diskutiert Marem Baibulatova. In ihrem Beitrag analysiert sie, wie eng die Schulwahl mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen in Beziehung steht und Ungleichheit reproduziert. Bei der von den Eltern ausgesuchten Volksschule spielt demnach die Distinktion zwischen privilegierten und deprivilegierten Gruppen eine wesentliche Rolle. Anschließend schildert die Autorin, welche politischen Interventionen gegen Schulsegregation bereits in den USA erprobt wurden.
Welche Bilder in Vorstellungsvideos von Schulen transportiert werden, beschreibt der Beitrag von Marlies Adler und Felix Strouhal. Die Präsentationen sind nicht nur ein direktes Wechselspiel zwischen den Ansprüchen der Eltern und jenen der Schule an sich selbst, sondern stellen auch die Erwartungshaltung der Schule an die Eltern dar. Die Botschaft ist subtil, die Konsequenzen aber tiefgreifend.
In direktem Zusammenhang mit diesen Mechanismen steht auch der Prozess der VerAnderung von Eltern mit Lernschwierigkeiten, mit dem sich Rahel More in ihrem Beitrag beschäftigt. Auf Basis ihrer 2017–2020 durchgeführten Studie gibt sie einen Einblick in das Leben und insbesondere die Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Als alleinerziehende Mutter eines Kindes mit hohem Unterstützungsbedarf und als Pädagogin untersucht Sonja Tollinger, wie gegenseitige Erwartungen von Eltern von Kindern mit Behinderungen und von Pädagog:innen in einem Schulsystem, das per se kein inklusiver Raum ist, zu Enttäuschungen und Schuldzuweisungen führen. In einem System, in dem Erziehungsberechtigte einen Teil der Verantwortung für den schulischen Erfolg der Kinder tragen müssen, zeigt sich die Kluft zwischen Anspruch und Realität ganz speziell im Kontext von Behinderung.
Ebenfalls aus der Perspektive einer Mutter von schulpflichtigen Kindern berichtet Angie Weikmann, die seit vielen Jahren in der Initiative „Bessere Schule Jetzt“ tätig ist. Sie beschreibt in ihrem Beitrag, wie wichtig es ist, dass Eltern und Pädagog:innen sich gemeinsam in bildungspolitischen Initiativen engagieren. Eltern können einen anderen Blickwinkel einbringen, werden aber auch bei den politischen Entscheidungsträgern oft viel ernster genommen. Sie müssen sich bei der Einbringung von Anliegen, sowohl der eigenen als auch jener der Pädagog:innen, nicht an vorgegebene Dienstwege halten.
Diese Bedeutung des Austausches zwischen Pädagog:innen und Eltern wird auch in Barbara Trautendorfers Artikel thematisiert – insbesondere als Grundvoraussetzung für bildungspolitisches Engagement von Menschen (innerhalb und außerhalb von Schule). Sie erzählt von ihren Erfahrungen aus vielen Jahren bildungspolitischem Aktivismus und Elternschaft von schulpflichtigen Kindern. Auf Basis dieser Erfahrungen geht sie der Frage nach, wer sich warum in diesem Bereich engagiert.
„Nie genug? Alleinerzieher:innen auf dem Prüfstand im Bildungssystem“ heißt der Beitrag einer Aktivistin, die bei FEM.A (Verein Feministische Alleinerzieherinnen) aktiv ist. Darin verknüpft die Autorin persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Befunden, um die vielen Aspekte der Diskriminierung von Alleinerzieher:innen und deren Kindern deutlich zu machen und die gesellschaftliche und politische Verantwortung dafür herauszustreichen.
Die darauffolgenden beiden Beiträge beschäftigen sich aus sehr persönlicher Perspektive mit dem Thema Eltern. In einem Brief an Lehrpersonen betont eine Mutter, wie wichtig offene und respektvolle Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften ist, um gemeinsam das Wohl des Kindes zu fördern und skizziert, wie sich diese im Lauf der Schullaufbahn ändert. Rosalinda schildert aus Sicht einer Neulehrerin ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Unsicherheiten und (systemimmanenten) Herausforderungen in der Elternarbeit.
Ellen Kollender setzt im nächsten Beitrag die diskriminierungskritische Analyse des Eltern-Schule-Verhältnisses fort, indem sie auf die Bedingungen für migrantisch gelesene Eltern und deren Partizipation an schulischen Prozessen eingeht. Die Autorin problematisiert sowohl die defizitorientierten Logiken und (kultur)rassistischen Annahmen über diese Eltern als auch Förderpolitiken, in denen Migrant:innen-Organisationen die Agenden und Interessen behördlicher und schulischer Entscheidungsträger in die Schule-Eltern-Kooperation einbringen. Mit community organizing diskutiert dieser Beitrag ein weiteres Konzept für gleichberechtigte Kooperationen und schulischen Wandel.
Danijela Radić beschreibt in ihrem Beitrag die vielfältigen Aufgaben der Freizeitpädagogik. Sie reflektiert über Begegnungen zwischen Eltern und Freizeitpädagog:innen, aber auch über die unterschiedlichen Erwartungen von Eltern an diese. Viele Herausforderungen im schulischen Alltag führen aufgrund fehlender Ressourcen zu Überforderungen. Radić nennt einen ganzen Katalog von Veränderungen, die es bräuchte, um eine gelingende Gestaltung der Freizeitpädagogik zu ermöglichen.
Im nächsten Beitrag gibt Maresi Strouhal einen kurzen Einblick in historische Entwicklungen in der Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Auf Basis persönlicher Erfahrungen schildert sie, wie sie Entwicklungen der letzten Jahrzehnte aus Sicht einer Lehrerin und später Schulleiterin wahrgenommen hat und welche Rolle dabei Psychologisierung und Singularisierungstendenzen spielen.
Die Wiener Orientierungsklassen und das Programm „Familie in Schule“ (FiSch) nimmt Ines Garnitschnig, Bildungsombudsfrau der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft, als Beispiel, um Gelingensfaktoren der Elternzusammenarbeit herauszuarbeiten. Angesichts der strukturell komplexen Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule hebt die Autorin das Beziehungsangebot statt abgedroschener Phrasen – „Partnerschaft auf Augenhöhe“ – hervor. Das bedeutet unter anderem, dass Eltern und Kinder Expert:innen ihrer Lebenszusammenhänge sind. Weniger Paternalismus seitens der Schule, dafür mehr Klarheit der Rahmenbedingungen, Rollen, zwischenmenschlichen Haltungen und Kommunikationsformen bilden demnach den Rahmen für gelingende Eltern-Schule-Zusammenarbeit.
Schließlich analysiert Judith Goetz in ihrem Beitrag Antifeministische Angriffe auf sexuelle Bildung. Zur Rolle von Eltern in der Berichterstattung über Kinderbuchlesungen von Dragqueens, wie normative Vorstellungen von Elternschaft in Medien reproduziert werden. Besonders problematisiert sie dabei, dass die Positionen rechter und konservativer Akteur:innen mitunter unkommentiert wiedergegeben werden, während die Auswirkungen von Angriffen auf Lesungen von Dragqueens für die betroffene Familien aus dem Blick geraten.
In der Gesamtheit der Beiträge bilden sich schemenhaft mögliche Ursachen für die vielfältigen Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Schule als Institution und Eltern, aber auch konflikthafte Situationen zwischen den handelnden Personen ab. Ursachen für eine gegenseitige Enttäuschung?
Marlies Adler, Verena Corazza, Barbara Falkinger,
Assimina Gouma, Iris Mendel
[1] In diesem schulheft haben wir uns dazu entschieden, den Begriff Eltern (und nicht Erziehungsberechtigte) zu verwenden, da er jene ideologische Aufladung und soziale Normativität besitzt, die problematisiert und hinterfragt werden soll. In den Beiträgen wird darauf eingegangen, inwiefern das Konzept Eltern und „Normalfamilien“ (vgl. Genovese & Ivanova-Chessex) den Diskurs dominiert und zu Ausschlusserfahrungen bei jenen Familien bzw. familienförmigen Konstrukten führt, die davon abweichen.
Autor:innen dieser Ausgabe
Herausgeberinnen
Marlies Adler
Verena Corazza
Barbara Falkinger
Assimina Gouma
Iris Mendel
Marlies Adler war einige Jahre als Lehrerin an einer Mittelschule im 20. Bezirk in Wien tätig und ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Wien. Mitherausgeberin des schulheft.
Marem Baibulatova studiert im Master LA Primarstufe an der PH Wien und arbeitet als Volksschullehrerin in Wien.
Verena Corazza, tätig in unterschiedlichen Berufsfeldern; von 1990 bis 2023 als Volksschullehrerin in Wien, davon 23 Jahre an der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau; Leiterstellvertreterin, Mitorganisatorin des Schulversuchs ILB – eine inklusive, ganztägige öffentliche Schule mit Mehrstufenklassen für 6- bis 15-Jährige.
Barbara Falkinger, Schulleiterin einer Wiener Mittelschule, davor Lehrerin an der Lerngemeinschaft 15, Wien. Langjährige Mitarbeit in elternverwalteten Kindergruppen, Mediatorin. Mitherausgeberin des schulheft.
Verein feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A. Die Autorin ist aktiv beim Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A, der für die Gleichstellung und Rechte von Alleinerzieher:innen und ihren Kindern kämpft. Alleinerzieher:innen bekommen Rat und Hilfe bei Fragen zu Obsorge, Kontaktrecht, Kindesunterhalt und Nachtrennungsgewalt sowie bei finanziellen Problemen.
Ines Garnitschnig, Psychologin und als Bildungsombudsfrau in der Kinder- und Jugendanwaltschaft der Stadt Wien tätig, wo ihre Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Demokratisierung von Schule, Gewaltprävention, Diskriminierungsschutz und Zugang zum Recht liegen.
Luisa Genovese, Junior Researcher am Forschungszentrum Kindheiten in Schule und Gesellschaft der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u.a. Migrationspädagogik, Bildung und (migrations-)gesellschaftliche Differenz- und Ungleichheitsverhältnisse und Fluchtmigrationsforschung.
Judith Goetz, Literatur-, Politik- und Bildungswissenschafterin, Rechtsextremismusexpertin und Gender-Forscherin. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU) und lehrt und forscht an der Universität Innsbruck.
Assimina Gouma, Sozialwissenschaftlerin und Hochschulprofessorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Elternkooperation und Sozialraumorientierung an der PH Wien.
Oxana Ivanova-Chessex, Senior Researcher und Dozentin am Forschungszentrum Kindheiten in Schule und Gesellschaft der PH Zürich. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen u.a. Bildung und (migrations-)gesellschaftliche Differenz- und Ungleichheitsverhältnisse, Eltern und Schule im Kontext gesellschaftlicher Ungleichheiten und differenz- und machtreflexive Professionalisierung von Lehrpersonen.
Ellen Kollender, Professorin für Inklusion und Diversität an der Leuphana Universität Lüneburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung. Sie befasst sich insbesondere mit migrationsgesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen, Rassismus und intersektionaler Diskriminierung im Schulsystem.
Iris Mendel, Philosophin und Sozialwissenschaftlerin sowie ausgebildete Lehrerin für die Fächer Deutsch und Psychologie/Philosophie. Sie arbeitet am Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung der Universität Graz.
Rahel More ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Wien und an der Universität Graz. Sie leitet dort Forschungsprojekte zu den Themen Ableismus und Intersektionalität, inklusive Kinder- und Jugendhilfe sowie De-Institutionalisierung.
Danijela Radić, geboren und aufgewachsen in Sarajevo. Sie hat ein Gymnasium abgeschlossen und ein Mathematikstudium nicht abgeschlossen. An der KPH Wien absolvierte sie den Masterlehrgang für Soziokulturelle Animation und Freizeitpädagogik. Seit 25 Jahren ist sie Freizeitpädagogin in Wien, Betriebsrätin und seit 2020 Teamleiterin.
Rosalinda ist Autorin, Podcasterin, Stand-up Comedian und seit dem Schuljahr 2024/25 auch als Lehrerin an einer integrativen Schule tätig. Aus der feministischen und gesellschaftskritischen Sprachkunst kommend, setzt sie sich viel mit der Macht der Sprache (natürlich auch im Unterricht) auseinander.
Felix Strouhal studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Lehramt der Primarstufe in Wien. Arbeitet seit sechs Jahren als Lehrer an einer Mittelschule im 20. Bezirk.
Maresi Strouhal war von 1977 bis 2020 als Lehrerin, in der Lehrer:innenfortbildung und als Schulleiterin in Wien tätig.
Sonja Tollinger ist Obfrau des Vereins Integration Tirol und Lehrerin an einer Polytechnischen Schule in Landeck. Als Mutter eines Kindes mit hohem Unterstützungsbedarf engagiert sie sich leidenschaftlich für inklusive Bildung. Zudem ist sie Mitbegründerin der Plattform „Gemeinsame Bildung 2.0“.
Barbara Trautendorfer ist als Redakteurin in einer Gewerkschaft tätig und Mutter zweier Töchter im Alter von zehn und zwölf Jahren. Sie war vier Jahre im Elternverein der ILB und engagiert sich bei „Bessere Schule Jetzt!“.
Angie Weikmann, selbständig in der IT-Branche tätig. Mitgründerin der Initiative „Bessere Schule Jetzt!“ (https://bessereschule.jetzt), Mitorganisatorin des Aktionstags Bildung 2023 und 2024 (https://aktion-bildung.at).
Bestellen
Studienverlag: Schulheft 198
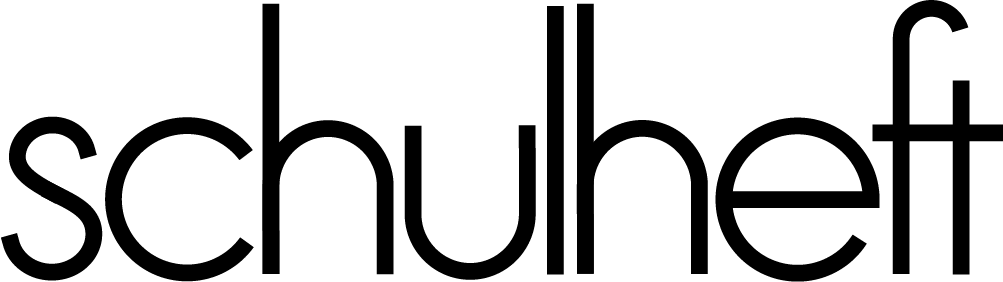
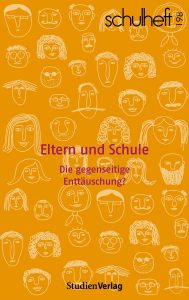 Klappentext
Klappentext