Feminismen
 Klappentext
Klappentext
Der Begriff des Feminismus existiert seit dem 19. Jahrhundert und setzte sich ab den 1960er Jahren mit den Neuen Frauenbewegungen international durch. Feministische Theorien und Praxen erlebten insbesondere in den letzten Jahrzehnten eine weitreichende Diversifizierung. Dieses schulheft stellt relevante Strömungen und zentrale Paradigmen des Feminismus vor. Damit werden auch Unterschiede zwischen ihnen verständlich, etwa indem die jeweilige Auffassung von Geschlecht, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft betrachtet wird. So können feministische Theorien kennengelernt und eine Orientierung in ihrer Diversität gefunden werden, was für pädagogische Belange von hoher Relevanz ist.
Inhalt
Editorial
Positionen im Feminismus
Marion Löffler
Neopatriarchat
Angela Wroblewski
Feministische Gleichstellungspolitik
Barbara Zach & Gabi Lener im Gespräch mit Aktivistinnen vom FZ
Autonomer und radikaler Feminismus
Einblick in Theorie und Praxis des autonomen Feminismus
Birge Krondorfer
Geschlechterdifferenz
Erklärt anhand des Denkens von Luce Irigaray
Johanna Grubner
Affidamento als politische Praxis der Freiheit
Heidemarie Ambrosch & Frigga Haug
Marxistischer Feminismus
Birgit Sauer
Zur feministischen Intersektionalitätsdebatte
Elisabeth Schäfer
De/konstruktiver Feminismus
Kelly Kosel
Queerer Feminismus, Queerfeminismus, Queer_feminismus, (queer)Feminismus?
Persson Perry Baumgartinger
Solidarität statt Spaltung
Was wir von den Anfängen des (westlichen) Trans*Feminismus lernen können
Anna Babka
Feministischer Posthumanismus
Simone Müller
Ökofeminismus, Nachhaltigkeit und Klima
Nima Obaro
Postkolonial-feministische Kritiken und Bildung
Gegenhegemonie dialogisch bilden
Aktuelle Problemlagen
Rosemarie Ortner
Geschlecht pädagogisch begegnen
Orientierungsversuch in der Vielfalt der Begriffe
Dshamilja Adeifio Gosteli
Queer-Feminismen: Ab in die Schule!
Die Notwendigkeit queer-feministischer Eltern*kooperation
Gerlinde Hacker & Dorothea Pointner
Warum der Deutschunterricht eine feministische Leseliste braucht
Vielfalt im Fokus
Susanne Hochreiter
Feminismus und Sprache
Ein Essay
Barbara Zach
„Sex matters“ im Feminismus
Barbara Grubner
Feminismus und Identitätspolitik
Elisabeth Klatzer
Care: Feministische Wege in die Zukunft
Lisbeth N. Trallori
Was bedeutet Leih- bzw. Mietmutterschaft im 21. Jahrhundert?
Ingrid Moritz
Feminismus als Hinterfragen der Herrschaftsverhältnisse
Autor:innen dieser Ausgabe
Editorial
Feminismus? Feminismen!
Den Begriff Feminismus gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert. Auf politisch-theoretischer Ebene setzte er sich international mit der Neuen Frauenbewegung ab den 1960er Jahren durch. Die Revolte der Frauen, ihre politische Praxis, ging Hand in Hand mit einem exorbitanten Lernprozess, in dessen Folge sich feministisches Wissen und Theorien bildeten, die je nach Herkunft, institutionellem Hintergrund und wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedliche gesellschaftliche, soziale, kulturelle und ökonomische Entwürfe erdachten.
Alsbald entstand eine Bandbreite von Kampf- und Denkschauplätzen zu den komplexen und ineinandergreifenden Ebenen des subordinierten Status von Frauen. Es gab von Anfang an divergierende Positionen im Feminismus und wellenartig heiße Debatten um Interpretationshoheiten, erkenntnistheoretische Prioritäten, politische Forderungen und Ziele.
Die feministischen Theoriebildungen, die Frauen- und Geschlechterforschungen sowie die Gender Studies füllen ganze Bibliotheken – übrigens ohne je in den allgemein anerkannten Wissenschaftskanon aufgenommen zu werden. Die widersprüchlichen, oft gegensätzlichen Perspektiven der verschiedenen Feminismen sind einerseits einer Fähigkeit zur Selbstkritik zu verdanken, über die sonst keine soziale Bewegung in diesem Ausmaß verfügt, und andererseits ist die Vielfalt des Feminismus durchaus abhängig von den je gesellschaftlichen und zeithistorischen Umständen.
Kursorisch skizziert jedoch gibt es einige Paradigmen, die in etwa chronologisch wie quer durch die Geschichte ein Gros der Strömungen subsumieren können. Diese lassen sich folgend benennen: – Egalitätstheorien (Gleichheit der Geschlechter, Gleichbehandlung, Frauen als homogene Gruppe); – Differenztheorien (Gleichwertigkeit des Geschlechterunterschieds, Frauen sind heterogen, weibliche Identität); – Dekonstruktive Theorien (Logo/Phallozentrismus konstitutiert gesamte Kultur, die Frau existiert eigentlich nicht); – Konstruktionstheorien (Gender entsteht interaktiv/performativ, Zweigeschlechtlichkeit als Konstrukt); – Intersektionale Theorien (Wechselwirkende Ungleichheiten, u.v.a. Klasse, Ethnizität, Alter, Sexualität).
Die Textkompilation dieses schulheftes versammelt die unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Zugänge und Haltungen. Dementsprechend gibt es in dieser Ausgabe auch keine einheitliche Genderschreibweise; das konnten die Autor:innen autonom entscheiden. Im engeren Sinn handelt es sich nicht um eine klassische Einführung in feministische Theoriebildung[1], auch wenn es für Lesende, für die die Thematisierung der Geschlechterverhältnisse Neuland ist, diesen Charakter haben kann. Intention war, einen Überblick über die diversen Strömungen des Feminismus zu ermöglichen, um in aktuellen Debatten eine Orientierung zu haben oder auch einfach zu einer Neugier auf geschlechterpolitische Reflexionen zu motivieren. Interne Debatten sind nicht abgebildet; die Autor:innen wurden gebeten, zu einer bestimmten Position (Teil 1) bzw. zu einer gesellschaftlichen Problemlage (Teil 2) eine Darstellung zu verfassen, wobei sich nolens volens Motive und Argumentationen überschneiden können.
Die Anordnung der Texte folgt gewissermaßen chronologisch den oben genannten Paradigmenwechseln, die sich allerdings schon in der Geschichte nicht linear, dennoch in Abgrenzung von und daher in Bezug aufeinander entwickelt haben. Diese Logik ist somit keine stringente und selbstredend sind die Beiträge aus heutigen Perspektiven geschrieben.
Übersicht der einzelnen Texte
Marion Löffler rekonstruiert die Geschichte des Begriffs Patriarchat als Vater/Söhne/Männerherrschaft, die seit der neuen Frauenbewegung im Fokus der Kritik steht, u.a. die moderne Trennung von privater und öffentlicher Sphäre. In Krisenzeiten schlägt das Patriarchat zurück und wehrt sich gegen die Verbesserung des Status von Frauen. Aktuell äußert sich das Neopatriarchat in wachsenden misogynen Internetplattformen, im Kult um traditionelle Lebensmodelle, aber auch in der modernisierten Form weiblicher Führungen rechtspopulistischer Parteien.
Angela Wroblewski skizziert in ihrem Beitrag Grundpfeiler feministischer Gleichstellungspolitik, die sie von Frauenförderung abgrenzt. Sie macht deutlich, dass eine Politik, die tatsächlich Gleichstellung fördert, bestehende benachteiligende Strukturen und Mechanismen verändern muss und jede Maßnahme auf ihre Gleichstellungswirkung hin zu hinterfragen ist. Nicht Individuen und deren Förderung dürfen dabei im Fokus der Politik stehen, sondern ein Strukturwandel, der auf genderanalytisch fundierten Maßnahmen und nachvollziehbaren Evaluationen basiert, ist anzustreben.
Drei Aktivistinnen des „Zentrums für Frauen, Lesben, Mädchen und Migrantinnen (FZ)“ in Wien geben in Form eines Interviews Einblick in den autonomen- bzw. Radikalfeminismus. Sie erzählen über Meilensteine ihrer Geschichte, über ihr Selbstverständnis, über Differenzen im Binnenraum sowie zu anderen feministischen Strömungen und über die Angriffe, denen sie heute von Seiten queer- und transfeministischer Aktivist*innen wie auch der Stadt Wien und dem WUK ausgesetzt sind.
Birge Krondorfer erklärt Differenzfeminismus entlang zentraler Gedanken von Luce Irigaray, der es um die Umwälzung einer Kultur geht, in der der Mann den universalen Menschen repräsentiert. Zu verabschieden ist damit eine Logik und Geschichte, in der Frauen nur als Spiegel für männliche Politik, Kultur, Ökonomie und Philosophie existieren; zu entwickeln wäre eine Differenz zur herrschenden Phallologik, eine Perspektive der Weiblichkeit im Alltag, in der Politik und in den wissenschaftlichen Diskursen.
Johanna Grubner präsentiert mit dem Affidamento ein Konzept einer frauenpolitischen Praxis der Freiheit. Das theoretische wie politisch-praktische Projekt entstand in den 1980er Jahren durch die Zusammenarbeit italienischer Frauengruppen und basiert auf sozialen, d.h. nicht-privaten Beziehungen zwischen Frauen; Beziehungen, die auf Differenzen beruhen. Und zwar auf der Differenz zwischen den Geschlechtern sowie auf der Differenz zwischen Frauen. Dabei geht es um Vertrauen, Anerkennung und Unterstützung des weiblichen Begehrens, sich an der Welt zu beteiligen.
Heidemarie Ambrosch & Frigga Haug sind Vertreterinnen des marxistischen Feminismus, wobei Frigga Haug dessen Entwicklung wesentlich mitgeprägt hat. Ihre hier abgedruckten „13 Thesen“ wurden und werden in globalen Zusammenhängen diskutiert und weiterentwickelt. Marxismus zielt zentral auf die Analyse der Produktions- und Reproduktionssphäre einer Gesellschaft, wobei der marxistische Feminismus betont, dass sämtliche (Re-)Produktionsverhältnisse zugleich Geschlechterverhältnisse sind. Alle Kämpfe dieser Verbindung sind gegen Herrschaft gerichtet und bedürfen einer Politik von unten.
Birgit Sauer untersucht die Entstehungsgeschichten der Debatten um Intersektionalität. Der Begriff meint die ineinander verflochtenen und sich gegenseitig bedingenden Diskriminierungen. Es werden Herrschaftsstrukturen analysiert, die historisch wie aktuell in kapitalistischen, patriarchalen, heteronormativen, neo-kolonialen Strukturen entstehen und sich verfestigt haben. Entwickelt hat sich diese multidimensionale Perspektive in den USA aus der Kritik von Schwarzen Frauen an der von bürgerlich-weißen Frauen dominierten feministischen Bewegung.
Elisabeth Schäfer beschreibt den de/konstruktiven Feminismus als Paradigmenwechsel in der Theoriebildung, besonders in den 1980er Jahren. Ausgehend von der strukturalen Psychoanalyse Jacques Lacans, der Dekonstruktion Jacques Derridas, der écriture féminine (weibliches Schreiben) von Autorinnen wie Hélène Cixous, Julia Kristeva, Luce Irigaray und queerer Écriture werden Projektionen, Subversionen, Auflösungen, Widerstände, Überschreitungen der Geschlechterordnung, des Denkens selbst und des Schreibens indiziert.
Kelly Kosel führt in die zentralen Gedanken queerfeministischen Theoretisierens und (politischen) Handelns ein: De-Konstruktion von Geschlecht, Kritik an Heteronormativität, am Denken in Binaritäten wie auch am Objektivitätsanspruch der Wissenschaft. Dem stellt sie queere TheoriePraxis, intersektionales Denken und u.a. das Konzept des „situated knowledge“ als Basis für „Freiheit, Stärke und Ehrlichkeit queerfeministischer Perspektiven“ gegenüber.
Persson Perry Baumgartinger schreibt über Geschichte und Theorien der Transbewegungen, die immer wieder vom Rechtspopulismus, der Allgemeinheit, aber auch von Feminist_innen diskriminiert wurden und wieder werden. Trans*Feminismen hingegen bemühten sich solidarisch wider Ausschlüsse, die sich u.a. in der Förderung und Entwicklung der Trans Studies äußerten. In Österreich konnten erst seit 2010 rechtliche Sicherheiten und Selbstbestimmung von Transpersonen erreicht werden und erst seit 2018 ist ein erweiterter Eintrag im Personenstand neben Frau und Mann möglich.
Anna Babkas Beitrag beschäftigt sich mit „feministischem Posthumanismus“, den sie als Teilbereich des Kritischen Posthumanismus versteht. Herkömmliche Vorstellungen vom Mensch-Sein werden analysiert und hinterfragt, insbesondere binäre Oppositionen, denen hierarchische Wertvorstellungen zugrunde liegen. Die Verschränkungen und gegenseitigen Beeinflussungen vielfältiger Differenz-, Ungleichheits- und Privilegierungsstrukturen werden machtkritisch in den Blick genommen und einige diesbezügliche theoretische Zugänge referiert.
Simone Müller bietet einen pointierten Überblick zur Geschichte und Gegenwart ökofeministischer Diskurse seit den 1970er Jahren. Es sind immer insbesondere Frauen, die die Proteste gegen das patriarchal-kapitalistische System und dessen sozial-ökologische Kosten initiier(t)en. Im Laufe der Jahrzehnte veränderten sich die Perspektiven, da auch diese Diskurse geprägt sind von Akademisierung, Neoliberalisierung und Globalisierung. Aber es geht nach wie vor um eine Politisierung der Natur- und Menschenausbeutung.
Nima Obaro beschäftigt sich mit postkolonialen Ansätzen, die die Verquickungen von hierarchischen Geschlechterordnungen, Rassismus und Kapitalismus erkennen und verändern wollen. Hier interessieren besonders jene hegemoniekritischen Wissenstheorien, die die europäische Zivilisierung als Herrschaft demontieren und gleichsam das Erbe der Aufklärung strategisch nutzen möchten. Es gälte, eine planetarische Ethik der Sabotage des ökonomischen Wachstumszwangs zu bilden und zudem die globale Ausbeutung der weiblichen Arbeit zu unterbinden.
Rosemarie Ortners Artikel über pädagogische Arbeit zu „Geschlecht“ diskutiert im Sinne von „Navigationshilfe“ aktuelle Konzepte auf ihre strategische Tauglichkeit. Ziel pädagogischer Arbeit sei es jedenfalls, Kinder und Jugendliche von den Zumutungen hegemonialer Geschlechtsrollenerwartungen zu entlasten, womit sich schließlich auch der Blick auf die Veränderung gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse, der geschlechtsbezogenen Arbeits- und Aufgabenteilung, struktureller Ungleichheit und der geschlechts- und sexualitätsbezogenen Normierung der Lebensweisen eröffnet.
Dshamilja Gosteli beleuchtet die Notwendigkeit queer-feministischer Eltern*arbeit und betrachtet die cisheteronormativen und rassismusrelevanten Machtverhältnisse, die tief in die Bildungsinstitutionen eingeschrieben sind. Auf die vielfältigen Lebensrealitäten von Schüler:innen kann mit Hilfe eines queer-feministischen Bewusstseins pädagogisch reagiert werden, die Teilhabe aller Eltern* wäre zu ermöglichen, wozu innerschulische, strukturelle Machtverhältnisse zu reflektieren wären. Es ginge dabei nicht um Diversitätsbekundungen, sondern um strukturelle Veränderungen.
Dorothea Pointner & Gerlinde Hacker berichten von einem Projekt, das in der von ihnen gegründeten Interessensgemeinschaft feministische Autorinnen (≠igfem) entwickelt wurde. Die feministische Leseliste soll der männlichen Dominanz der Schullektüren entgegenwirken. Es braucht Erzählungen, Wahrnehmungen, Theorien aus weiblichen Perspektiven, denn Lesewelten und Schulwissen prägen fürs Leben. Ein interdisziplinäres Gremium aus 34 Expertinnen erstellt den kuratierten Kanon aus über 1000 eingereichten Titeln.
Susanne Hochreiters Essay betrachtet Sprache als ein gesellschaftliches und politisches Phänomen, das – auch historisch – immer wieder umkämpft ist. Radikale Kritik an bestehenden Macht- und Gewaltverhältnissen zwischen den Geschlechtern sucht auch nach einer Veränderung der Sprache. Debatten um Sprache werden daher seit Beginn der Frauenbewegung(en) intensiv geführt, um sprachliche Asymmetrien und Strukturen, die Frauen benachteiligen, aufzulösen. Dieser Anspruch dehnt sich heute auf intergeschlechtlichen Menschen und Transgender-Personen aus.
Barbara Zach erinnert daran, dass Feminismus als Frauenbewegung entstanden ist und deren Legitimität durch die nachhaltige Unterordnung von Frauen nach wie vor gegeben ist. Die gewalthaltige Ideologie der ‚Naturalisierung‘ der gesellschaftlichen Funktionen von Frauen gilt immer noch, d.h. die unterschiedliche Körperlichkeit begründet ihre Platzierung. Der Queer- und Transfeminismus bestreitet diesen Zusammenhang, indem er alles Geschlechtsbiologische als binäre Kategorisierung ablehnt. Dabei verstrickt er sich in zahlreiche Widersprüche.
Barbara Grubner kritisiert die aktuell dominierende Tendenz, Feminismus als Identitätspolitik zu sehen. Die gesellschaftlichen Errungenschaften der Entgrenzung und Entnormierung von Geschlecht und Sexualität in den letzten Jahrzehnten haben wenig an der robusten Geschlechterhierarchie geändert. Werden Frauen als Identitätskonstruktion angenommen, wird nicht nur die Eingeschlechtlichkeit der symbolischen Ordnung nicht wahrgenommen, sondern auch der Zugriff auf die Gratisarbeit von Frauen im Kapitalismus verdeckt.
Elisabeth Klatzer macht deutlich, dass ohne die vornehmlich von Frauen getragene, bezahlte und unbezahlte Carearbeit die gesamte Wirtschaft nicht funktionieren würde. Die Abwertung der Sorgetätigkeiten steht diametral deren Notwendigkeit gegenüber; wir alle können ohne Pflege und Schutz nicht leben. Deshalb braucht es eine grundlegende Transformation der Wirtschaft in Richtung gemeinnützige Lebensbedingungen und einem solidarischen Menschenbild, um die sich das österreichische Netzwerk ‚fair sorgen‘ bemüht.
Lisbeth N. Trallori setzt sich mit Leih- und Mietmutterschaft auseinander. Sie zeigt auf, dass das Selbstverständnis, wonach Menschen als Teil der Natur anzusehen seien, einer zunehmenden Fragmentierung unterworfen ist. Neben reprotechnischen Veränderungen kritisiert sie vor allem auch deren durchgehende Kommerzialisierung auf der Basis der weltumfassenden Neoliberalisierung, was eine potentielle Verwandlung des Körpers von Frauen in ökonomischen Notlagen in käufliche Rohstoffe bewirkt – und womit Kinder-, Frauen- und Menschenrechte zutiefst verletzt werden.
Ingrid Moritz skizziert ihr Verständnis von feministischer Arbeit anhand von zwei Studien, wobei es bei der einen um die Erfahrungen von jungen Frauen und Männern mit sexueller Belästigung beim Einstieg in die Arbeitswelt geht und die andere sich mit der Benachteiligung nichtösterreichischer Staatsbürger:innen am Arbeitsmarkt beschäftigt. Durch beide Studien wird der Zusammenhang von Diskriminierung und Machtverhältnissen gut ersichtlich.
Wenn wir mit den präsentierten Reflexionen bei den Leser:innen ein Begehren nach einmischender Veränderung diskriminierender Herrschaftsverhältnisse (wieder) erwecken konnten, dann wäre unser Bemühen gelungen.
Wir danken Julia Köhler für die temporäre Mitarbeit. Und wir danken den Autor:innen für ihr Engagement ausdrücklich, denn ohne sie wäre diese Publikation schlicht nicht auf die Welt gekommen. Es bleibt jetzt noch festzuhalten, dass die Herausgeberinnen und der Vorstand des Vereins schulheft nicht mit den Standpunkten aller Texte übereinstimmen.
Birge Krondorfer, Gabriele Lener, Barbara Zach
[1] Dazu gibt es Handbücher, Lexika und Einführungen zur Frauenbewegungsgeschichte, zu Feministischen Theorien, zu den Genderstudies.
Autor:innen der Ausgabe
Herausgeberinnen
Birge Krondorfer
Barbara Zach
Gabi Lener
Heidemarie Ambrosch ist Frauensprecherin der KPÖ, Vorstandsmitglied im Österreichischen Frauenring, Mitbegründerin der Plattform 20000frauen sowie dem Netzwerk FAIRsorgen! Wirtschaften fürs Leben. Als Vertreterin für transform.at ist sie in der Leitung von transform europe.
Anna Babka ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Politikerin. Sie arbeitet am Institut für Germanistik der Universität Wien. Forschungsschwerpunkte sind Literatur- und Kulturtheorie, Theorie der Auto-/Biographie, kulturwissenschaftliche Geschlechterforschung, Cyberfeminismus und Posthumanismus, Queer Studies und Postcolonial Studies.
Persson Perry Baumgartinger, Promotion in angewandter Sprachwissenschaft & Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Gründer von TransCommBüro für transformative Kommunikation. Workshops, Publikationen und Lehre zu Trans Studies, kritische Diskurs- und Dispositivanalyse, Trans-Arts & Cultural Production, Social Sustainability u.a.m. www.baumgartinger.net
Angela (FZ) ist seit vielen Jahren frauenpolitisch und feministisch aktiv.
Claudia (FZ) ist Aktivistin im FZ Wien. In der autonomen FrauenLesbenBewegung sind kollektive Frauenbefreiung, der Erhalt von Frauenräumen und Frauenrechten, sowie die Vernetzung von Frauen und Lesben ihre Hauptanliegen. Beruflich unterstützt sie Menschen mit Behinderung in Selbstbestimmungs-Prozessen.
Lisa (FZ) ist Schlosserin; feministische Aktivistin u.a. gegen sexuelle Gewalt, gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, gegen Faschismus und Krieg und in der Praxis feministischer Selbstverteidigung. Autonome Frauenorganisierung zur Überwindung von Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus kennzeichnet ihren Weg und prägt ihre Perspektiven.
Dshamilja Adeifio Gosteli (sie/dey) ist Erziehungswissenschaftler:in, Lehrbeauftragte, Pädagog:in und an der Universität Wien am Referat Genderforschung tätig. Sie promoviert in Bildungswissenschaft an der Universität Wien und arbeitet forschend an der Schnittstelle von Bildung und sozialer Gerechtigkeit.
Barbara Grubner ist Sozialwissenschaftlerin, Psychoanalytikerin in Ausbildung unter Supervision, Mitarbeiterin in der Beratungsstelle sexuelle Belästigung und Mobbing der Universität Wien. Publikationen zu feministischer Theorie, Denken der sexuellen Differenz und psychoanalytischer Kulturtheorie.
Johanna Grubner ist Mitarbeiterin an der Abteilung für Gesellschaftstheorie und Sozialanalysen am Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz. Schwerpunkte sind Gesellschaftstheorie und Geschlechterforschung. Mitgründerin des feministischen Wissenschaftskollektivs Zwischen Institution und Utopie.
Gerlinde Hacker ist Schriftstellerin, Literaturaktivistin und Projektleiterin. Sie schreibt Lyrik, Prosa und performative Texte und engagiert sich für feministische Literatur und Sichtbarkeit von Autorinnen. Als Gründerin und Präsidentin der ≠igfem – Interessensgemeinschaft feministische Autorinnen – organisiert sie Schreiblabore, Lesungen, Workshops und internationale Projekte. www.gerlindehacker.com – www.hackerin.at – www.igfem.at
Frigga Haug war Professorin für Soziologie bis 2001 und hatte internationale Gastprofessuren; sie ist Mitherausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Das Argument und des Historisch-Kritischen Wörterbuch des Marxismus; unzählige Publikationen, u.a.: Der im Gehen erkundete Weg – Marxismus-Feminismus, 2015.
Susanne Hochreiter ist Literaturwissenschaftlerin am Institut für Germanistik der Universität Wien, Arbeitsschwerpunkte im Bereich der neueren deutschsprachigen Literatur, Gender und Queer Studies sowie Comics-Forschung; verschiedene Beiträge zum Thema Sprache und Geschlecht.
Elisabeth Klatzer ist feministische Ökonomin, Arbeitsschwerpunkte: geschlechtergerechte Budget- und Wirtschaftspolitik, Bewegungsarbeit in Richtung eines demokratischen Wirtschaftens; Aufbauarbeit und langjähriges Vorstandsmitglied bei Attac, Mitinitiatorin von FAIRsorgen!.
Kelly Kosel lehrt, schreibt und promoviert an den Schnittstellen von Gender Studies, Bildungswissenschaften und Kunst. Sie macht diskriminierungskritische Sexualpädagogik und queere Bildungsarbeit und ist im Vorstand des Bildungsvereins Zweite Aufklärung sowie der Plattform Sexuelle Bildung, der Vertretung sexualpädagogischer Expert*innen.
Birge Krondorfer ist politische Philosophin und feministisch engagiert. Univ. Lehrende und Frauen/Erwachsenenbildung; Inter/nationale Vorträge, Moderationen, Seminare, Publikationen, (Co-)Herausgaben und Redaktionen in kritischer Perspektive zu Theorien und Praxen der Geschlechterverhältnisse.
Gabi Lener, Soziologin und Lehrerin, leitet eine inklusive Ganztagsvolksschule in Wien.
Marion Löffler ist Lektorin an der Universität Wien und der Fachhochschule des BFI Wien in den Bereichen Politikwissenschaft und Gender Studies. Arbeitsschwerpunkte: Politische Männlichkeiten, feministische Staatstheorien, Geschlechterdemokratie und Parlamentsrhetorik.
Ingrid Moritz ist Politikwissenschafterin, Arbeitsmarktexpertin und Rechtsberaterin zu Fragen des Mutterschutzes, Elternkarenz und Gleichbehandlungsrecht, von 2002 bis 2017 Ersatzmitglied des AMS-Verwaltungsrats, Vorstandsmitglied im österreichischen Frauenring, ab 1998 bis zur Pensionierung 2023 Leitung der Frauenabteilung der AK Wien, ausgezeichnet mit dem Wiener Frauenpreis.
Simone Müller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Erwachsenen- und Weiterbildung der Universität Graz. Sie forscht zu ökofeministischer, dekolonialer und posthumanistischer Herrschaftskritik sowie zu disziplin-, theorie- und erkenntnispolitischen Fragestellungen.
Nima Obaro ist feministische Erwachsenenbildnerin, Aktivistin, Sozialarbeiterin, Betriebsrätin. Sie engagiert sich in selbstorganisierten Kontexten zu kritischer / politischer Bildungsarbeit und schreibt Texte an der Schnittstelle von Theorie und Praxis.
Rosemarie Ortner ist Bildungswissenschafterin und Mitarbeiterin im Verein EfEU (www.efeu.or.at). Als Referentin in Aus- und Fortbildung für Pädagog*innen beschäftigt sie sich mit Geschlecht, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt sowie Intersektionalität als Themen pädagogischer Professionalisierung.
Dorothea Pointner ist tätig als Korrektorin und im Kultur-Projektmanagement. Publikationen von Lyrik und Kurzprosa in Anthologien, Literaturzeitschriften und Rundfunk sowie Lesungen. Mitbegründerin und Vizepräsidentin der ≠igfem – Interessensgemeinschaft feministische Autorinnen. https://doropointnerblog.wordpress.com/, www.igfem.at
Birgit Sauer ist Professorin i.R. für Politikwissenschaft, Universität Wien. Forschungen: feministische Staats- und Demokratietheorie; autoritäre Rechte und Geschlecht; Staat, Emotionen und Affekte. Jüngste Veröffentlichung: Gundula Ludwig und Birgit Sauer (Hg.): Das kälteste aller kalten Ungeheuer? Annäherungen an intersektionale Staatstheorie, Frankfurt/M. 2024.
Elisabeth Schäfer ist Philosoph*in. Sie* forscht und lehrt zu Dekonstruktion, Queer-Feministischer Philosophie, Psychoanalytischer Theorie, Körper, Gewalt und Traumata, écriture feminine, Schreiben als künstlerischer Forschung und widerständiger Praxis. Sie* ist als Privatdozent*in und stellvertretende Departmentleiter*in an der SFU PTW LINZ tätig.
Lisbeth Nadia Trallori ist feministische Soziologin und Politikwissenschafterin, wirkte an österreichischen Universitäten. Studien zu Körperpolitik/en, zu Biopolitik und Reproduktion, zu Nationalsozialismus und Widerstand. Ausgezeichnet mit dem Käthe-Leichter-Preis sowie dem Gabriele Possanner-Preis für Geschlechterforschung.
Angela Wroblewski ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Höhere Studien in Wien. Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Evaluation von Gleichstellungsmaßnahmen in Wissenschaft und Bildung.
Barbara Zach ist Erwachsenenbildnerin und Sozialarbeiterin mit langjähriger Praxis in den Arbeitsfeldern Flucht/Migration, psychosoziale Versorgung, Frauen- und Mädchenberatung. Freiberuflich Lehrende an FH und Universität. Feministin und Marxistin.
Bestellen
Studienverlag: Schulheft 199
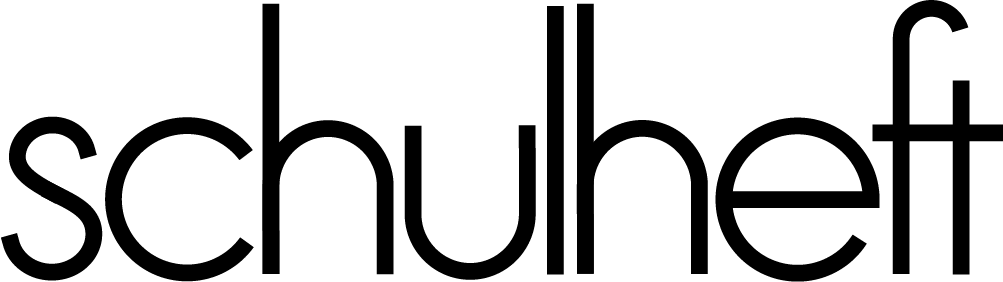
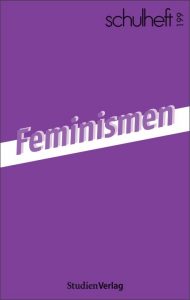 Klappentext
Klappentext